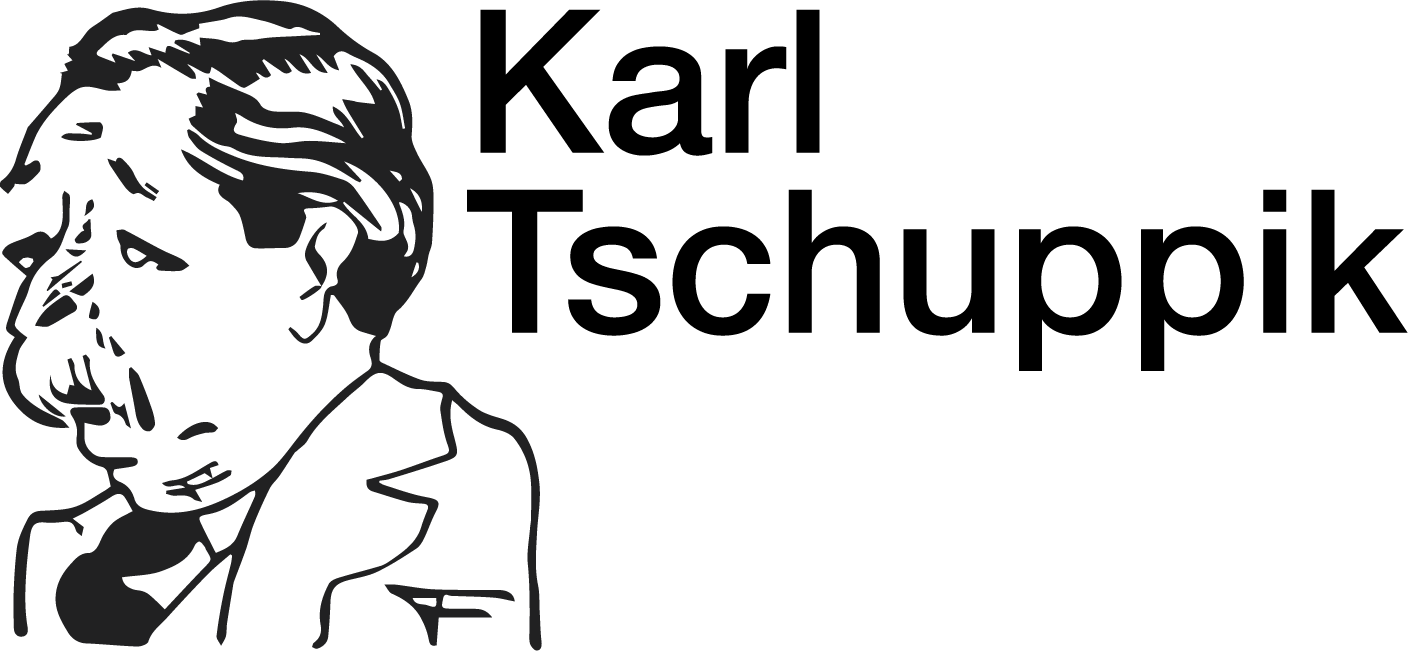Verdorben in Wien
Während des Krieges unterschied sich das „Prager Tagblatt“ zu seinem Vorteil von der übrigen deutschbürgerlichen Presse: es bekämpfte mit Ernst und Nachdruck die damals marktgängige deutsche Politik, die von der Gunst der Regierung nationale Vorteile erhoffte und ihre Sache auf Patente und Ordonnanzen gestellt hatte. Die Haltung war wesentlich das Verdienst Karl Tschuppiks, der sich aus einer sozialdemokratischen Vergangenheit demokratische Gesinnung gerettet hatte. Herr Tschuppik ist nun nach Wien gekommen; hier ist er bald und gründlich verdorben worden. Nach einem kurzen Zwischenspiel bei Herrn Karpeles wirkt er wieder im „Neuen Wiener Tagblatt“; und der Geist Siegharts schwebt über ihm. Er schreibt jetzt, was dem Spießbürger gefällt. Und was gefällt jetzt dem guten Bürger? Das Schimpfen auf die Sozialdemokratie! Herr Tschuppik liefert es in dem „Prager Tagblatt“ – seine Wiener Artikel können wir nicht agnoszieren – in trefflicher Weise. Daß er das Schimpfen mit demokratischen Phrasen verbrämt, zeigt, daß er noch das Bedürfnis nach einem Alibi hat; aber die Verbrämung täuscht nicht über die Absicht. Man höre folgenden Wutausbruch:
Die politisch führende Intelligenz fängt an, der Lakai des Pöbels von unten zu werden. Die Menge ist heute politisch frei, sie hat alle Rechte und die ganze Macht. Jetzt also wäre es Pflicht, ihr die Wahrheit zu sagen. Vor diesem Amt jedoch schrickt der größte Teil der Führer genauso zurück, wie er es ehedem nicht gewagt hat, den Mächtigen das Notwendige zu sagen. In allen Reden und Versammlungsbeschlüssen wimmelte es von Umschmeichlungen der Masse. Sie ist der Herr und was sie tut und will, ist wohlgetan und herrlich. Kein Wunder danach, wenn der Lakai der Masse selbst vor diesem Publikum kapituliert und vor dem widrigen Götzenbild Werke des Geistes verbrennt.
Also was ist geschehen, das diese Aufregung erklären könnte? In Wiener Neustadt gab es einen Theaterkrawall und der beweise, „daß der größte Teil der öffentlich wirkenden Intelligenz genauso versage, wie er ehedem im alten Österreich versagt hat“. Welche „Wahrheit“ soll nun die „Intelligenz“ der „Masse“ sagen? Nun es soll sie lehren, das „Neue Wiener Tagblatt“ zu ehren, eben Respekt vor den „Werken des Geistes“! Die Möglichkeit nämlich, daß der kapitalistischen Presse ein bißchen die Flügel gestutzt werden können, bringt den Wahrheitsfanatiker aus dem Häuschen:
Bezeichnend für den hysterisch erregten Geist, der den sozialistischen Radikalismus befeuert, ist der Kampf gegen die bürgerliche Presse. Nachdem der linkssozialistische Literatenradikalismus (Herr Tschuppik ist zwar dafür, „der Masse“ die Wahrheit zu sagen, aber vor seinen Abonnenten verwandelte er vorsichtigerweise die Menschen in Begriffe) mit einer Sophistik, die den seligen Stürgkh entzückt hätte, die unbeschränkte Preßfreiheit verneint hat, will er jetzt eine Art Zensur der Arbeiterräte einführen, die darin bestehen soll, daß die Vertrauensleute der Setzer auf kurzem Wege jede Kritik der Regierung zu verhindern hätten. Man muß schon sagen, neben den Anwälten eines solchen Gedankens erscheinen die Badeni, Thun, Stürgkh und Seidler als freigeistige Giganten. Dazu gehört dann als Ergänzung des Radikalismus, der jedem unbequemen Kritiker das Papier abjagt. Auch die Polemik Dr. Renners (in der Nationalversammlung) gegen die bürgerliche Presse, die sich in einer Regierungserklärung komisch genug ausnahm, scheint nur unter dem Drucke der Hysteriker zustande gekommen zu sein.
Von den niedlichen Fälschungen – daß man zum Beispiel, wenn man dem kapitalistischen Einfluß auf die Presse entgegenwirkt, noch lange nicht die „Preßfreiheit verneint“; daß man niemandem das Papier abjagt, vielmehr das „Papier“ für alle gleichmäßig festsetzen will; daß die Behauptung, man hätte von den Setzern verlangt, daß sie „auf kurzem Wege jede Kritik der Regierung zu verhindern hätten“, schon längst als alberne Lüge entlarvt ist – von den tatsächlichen Fälschungen wollen wir gar nicht reden. Aber welch ein Geist, der den Kampf gegen die kapitalistische Presse, dieses Teufelsinstrument zur Verblödung und Vergiftung der Menschen, komisch findet! Und weil man sich gegen diesen Schandfleck der Kultur und Moral zur Wehr setzt, die Faselei wagt, daß just das beweise, „daß Wien auch unter dem roten Banner die alte Sklavenstadt blieb, in der nicht die Sache, sondern die Person gilt und persönliche Eitelkeit und Herrschsucht stets viel wichtiger waren als die Erledigung der dringenden Aufgaben“. Das Gerede hat ja eigentlich keinen Sinn; man sieht nur den mißvergnügten Feuilletonpolitiker, der schimpft, weil er mit sich selbst unzufrieden ist. Herr Tschuppik mag es als ein übles Ende empfinden, daß er bei Sieghart Handgeld genommen, und um das zu vertuschen, täuscht er sich eine weltverachtende Enttäuschung vor, die ihn dazu geführt habe, „sich mit Ekel von der Politik abzuwenden, die den Kampf der politisierenden Hysteriker als ein geschichtemachendes Ereignis hinnimmt“. Nietzsche in Sieghartausgabe! Die Verachtung des Herrn Tschuppik gegen die „geschichtemachenden Hysteriker“ ist doch nicht mehr als die Beschönigung seines Abfalls von Geistigkeit und Demokratie.
In seiner Art ist der Fall Tschuppik schon der Beachtung wert. Einesteils zeigt er, wie sich der bürgerliche Demokrat, da es ums Ganze geht, rasch in den verärgerten Spießbürger rückverwandelt, und zweitens erfährt man es wieder einmal, wie die Wiener Luft Charakter und Gesinnung verdirbt.
[Arbeiter-Zeitung, Jg. 31, Nr. 300, 1.11.1919, Morgenblatt, S. 5-6 (ohne Signatur).]
Die Passagen, die die „Arbeiter-Zeitung“ zitiert, lauten bei Tschuppik:
[…] Bezeichnend für den hysterisch erregten Geist, der den sozialistischen Radikalismus befeuert, ist der Kampf gegen die bürgerliche Presse. Auch den Hysterikern mit kommunistischer Frisur war sie ehedem die Hauptsache; da sich jeder von ihnen im Geiste schon als Chefredakteur irgendeines der großen Wiener Blätter sah, predigten sie das Recht auf gewaltsame Besitzergreifung. Der linkssozialistische Literatenradikalismus schlug einen anderen Weg vor. Nachdem er mit einer Sophistik, die den seligen Stürgkh entzückt hätte, die unbeschränkte Preßfreiheit verneint hat, will er jetzt eine Art Zensur der Arbeiterräte einführen, die darin bestehen soll, daß die Vertrauensleute der Setzer auf kurzem Wege jede Kritik der Regierung zu verhindern hätten. Man muß schon sagen, neben den Anwälten eines solchen Gedankens erscheinen die Badeni, Thun, Stürgkh und Seidler als freigeistige Giganten. Dazu gehört dann als Ergänzung der Radikalismus, der jedem unbequemen Kritiker das Papier abjagt. Auch die gestrige Polemik Dr. Renners gegen die bürgerliche Presse, die sich in einer Regierungserklärung komisch genug ausnahm, scheint nur unter dem Drucke der Hysteriker zustande gekommen zu sein.
Die theoretisierenden Köpfe, die ihre Parteibüchel auswendig gelernt haben, wollen der Welt natürlich weismachen, daß es sich bei diesem Spiel um den Klassenkampf handelt. Die Wahrheit aber ist, daß Wien auch unter dem roten Banner die alte Sklavenstadt blieb, in der nicht die Sache, sondern die Person gilt und persönliche Eitelkeit und Herrschsucht stets viel wichtiger waren als die Erledigung der dringenden Aufgaben. Gewiß ist auch ein Teil der bürgerlichen Welt und des bürgerlichen Journalismus von diesem Erzübel nicht losgekommen. Aber die Erneuerer, auf die man einst die große Hoffnung gesetzt, haben erst recht enttäuscht. Kein Wunder danach, wenn ein großer Teil der Bevölkerung, der an die heilende Kraft der Demokratie geglaubt hat, sich heute mit Ekel von der Politik wieder abwendet und die gläubigen Massen bedauert, die den Kampf der politisierenden Hysteriker als ein geschichtemachendes Ereignis hinnimmt.
[Die Herrschaft der Hysteriker.In: Prager Tagblatt, Jg. 44, Nr. 252, 25.10.1919, Morgen-Ausgabe, S. 1 (Pfeil).]
[…] Worin bestand denn das eigentliche Verhängnis des zerbrochenen Staates, worin der erniedrigende schmachvolle Zustand von ehedem? Wahrlich, nicht so sehr in der Tatsache, daß Millionen von Menschen von größtenteils ungebildeten und zynischen Menschen regiert wurden, denn diese Regierenden bildeten ein Stück der historischen Überlieferung, die zu beseitigen mit normalen Kräften nicht möglich war. Die Schmach und Schande Österreichs war das Verhalten seiner Gebildeten, seiner Intelligenz, die aus Rücksicht auf Fortkommen und Gewinn alles guthießen und den Herrschenden schmeichelten. Die Intelligenz war der Lakai des Pöbels nach oben. An diesem Lakaientum sind wir zugrundegegangen, da niemand in Presse, Parlament und Gesellschaft den Mut zur Wahrheit fand. Heute droht dieselbe Gefahr mit umgekehrten Vorzeichen. Die politisch führende Intelligenz fängt an, der Lakai des Pöbels von unten zu werden. Die Menge ist heute politisch frei, sie hat alle Rechte und die ganze Macht. Jetzt also wäre es Pflicht, ihr die Wahrheit zu sagen. Vor diesem Amt jedoch schrickt der größte Teil der Führer genauso zurück, wie er es ehedem nicht gewagt hat, den Mächtigen das Notwendige zu sagen. In allen Reden und Versammlungsbeschlüssen wimmelt es von Umschmeichlungen der Masse. Sie ist der Herr, und was sie tut und will, ist wohlgetan und herrlich. Kein Wunder darnach, wenn der Lakai der Masse selbst vor diesem Publikum kapituliert und vor dem widrigen Götzenbild Werke des Geistes verbrennt.
[Lakaien der Masse. In: Prager Tagblatt, Jg. 44, Nr. 253, 26.10.1919, Morgen-Ausgabe, S. 1 (Pfeil).]
„Verdorben in Wien“. Eine Entgegnung
Die „Arbeiter-Zeitung“ nimmt zwei meiner letzten im „Prager Tagblatt“ erschienenen Artikel zum Anlaß, sich mit meiner Person zu beschäftigen und unter dem Kinotitel „Verdorben in Wien“ ein Bild zu entwerfen, das mich als einen bedauernswerten Mann zeigt, der einst eine gute Sittennote besaß, seiner besseren Gesinnung aber untreu geworden ist und heute, vom Wiener Sumpf verdorben, nur mehr tut, „was dem Spießbürger gefällt“, nämlich auf „die Sozialdemokraten zu schimpfen“. Dem Bilde wird auch eine Erklärung beigefügt, die behauptet, meine „vorgetäuschte Weltverachtung“ sei nichts anderes als der Versuch, den eigenen Sündenfall zu verbergen und den „Abfall von Geistigkeit und Demokratie“ zu beschönigen. Ich würde das melancholische Konterfei, das die „Arbeiter-Zeitung“ von mir entwirft, gern für mich behalten, aber sie selbst rückt es ins Allgemeinere, indem sie sagt, der Fall sei beachtenswert, weil er zeige, wie sich der „bürgerliche Demokrat, wenn es ums Ganze geht, rasch in den verärgerten Spießbürger rückverwandelt“. Sie gibt mir dadurch die Möglichkeit, mehr von der Sache als von der Person zu sprechen.
Wodurch soll dieser Verrat am Geiste und an der Demokratie begangen worden sein? In dem einen der zwei erwähnten Artikel habe ich mich mit einem Fall beschäftigt, der in Wien totgeschwiegen wurde, mir aber als ein charakteristisches Beispiel für die Abhängigkeit der politisch führenden und regierenden Männer von jeder Massengesinnung erschien. Und charakteristisch war dieser Fall, weil hier eine unzweideutig niedrige Gesinnung in Schutz genommen wurde. Vor die Wahl gestellt, ein geistig bedeutsames Werk ohne Rücksicht auf gemeine Instinkte freizugeben, oder das Werk eben aus Rücksicht auf diese Instinkte zu unterdrücken, entschied sich die republikanische Regierung für die Unterdrückung. Ich sagte nun, in einem solchen Falle bestehe kein Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Österreich: das alte Österreich hatte Werke, die tatsächlich an den Leib rückten, einfach verboten, weil jede Entschleierung der eingebildeten Welt verboten war; das neue Österreich verbietet Entschleierungen, weil sie einem Teil der Masse nicht genehm sind. Und dazu bemerkte ich nun, es scheine unser tragisches Verhängnis zu sein, daß die politisch führenden Menschen nicht den Mut aufbringen, ihrem Intellekt treu zu bleiben, während die alten nach oben dienerten, dienern die neuen nach unten.
Das von mir herangezogene Beispiel enthielt keine Beschimpfungen der Sozialdemokratie, sondern die politisch wichtige Frage, ob es im Wesen der Demokratie begründet ist, auch dann eine Massengesinnung oder Massenstimmung zu berücksichtigen, wenn diese Gesinnung oder Stimmung schlechten Instinkten und einer niedrigen Denkungsart entspringen. Darauf hat man mir nicht geantwortet, nicht einmal mit dem naheliegenden und sonst üblichen Argument von den praktisch-politischen Erwägungen. Aber ich verstehe wohl, warum dieses Thema nicht erwünscht ist, und weiß, daß ich vergebens darauf warten könnte, eine Antwort zu bekommen. Denn dieses Thema berührt einen wunden Punkt der regierenden Sozialdemokratie, ihren Verzicht nämlich auf jeden geistigen Mut, sofern es sich um Angelegenheiten handelt, die außerhalb des ökonomistischen Programms liegen. Ich weiß, was man mir erwidern wird, und kenne alle Einwände ganz genau; nur ein Dummkopf kann heute noch die Fundamentalität des Wirtschaftlichen bestreiten, sicher ist die Änderung der wirtschaftlichen Grundlage, die gerechte Verteilung der notwendigen Arbeit die erste Voraussetzung für eine glücklichere Zukunft. Aber so gewiß eine Umgestaltung der Wirtschaft zugleich außerwirtschaftlich viel Gutes bringen würde, so gewiß ist es auch, daß die rückständige Wirtschaft nicht die einzige Rückständigkeit bildet. Nun aber ist es der österreichischen Sozialdemokratie, nicht durch ihre Schuld, versagt, im Ökonomischen revolutionär zu sein; sie kann in diesem Lande des Elends nicht an die Wirtschaft rühren, ohne nicht den letzten Rest von Produktion zu gefährden, es wäre denn, daß man das Ziel des östlich-tatarischen Bolschewismus gutheißt und an die Erneuerungsfähigkeit der Menschheit aus dem Chaos glaubt. Aber wer nicht gerade ein Anhänger jener mechanischen Lehre von der Ausschließlichkeit des Ökonomischen ist, die nur von der Änderung der Wirtschaft als automatische Folge die Umgestaltung der geistigen Welt erwartet, der wird finden, daß die regierende Sozialdemokratie trotz ihrer Ohnmacht im Ökonomischen immerhin ein weites Feld der Arbeit vor sich hätte.
Die „Arbeiter-Zeitung“ möchte meine „Enttäuschung“ als die Reaktion eines braven Spießers hinstellen, der in den schönen Tagen der Gefahrlosigkeit der „bürgerliche Demokrat“ war, nun aber, da es „ums Ganze geht“, zurückschreckt und zu greinen beginnt. Ich kenne auch dieses Bild aus der sozialistischen Literatur; aber ich muß schon sagen, hier liegt die falsche Anwendung eines klassischen Zitats vor. Ich und viele meinesgleichen mögen wohl enttäuscht sein, aber doch nicht, weil es „ums Ganze geht“, sondern umgekehrt, weil es eben nicht „ums Ganze“ geht. Tausende Menschen meinesgleichen, die weder ökonomisch noch geistig an der Konservierung des alten Zustands interessiert sind, werden der alten Ordnung keine Träne nachweinen; daß sie aber enttäuscht sind, liegt nicht an ihren „Bourgeois“- oder Spießerinstinkten, sondern an der Spießerhaftigkeit der sozialdemokratischen Politik, sobald es um Dinge geht, die außerhalb des Ökonomischen liegen. Es ist ein sehr bequemes Mittel, und eine Schablone, deren ich mich als Sozialdemokrat zu bedienen nachgerade schämen würde, jeden Menschen, der aus reinen Motiven des Nachdenkens werte Erscheinungen in einem der regierenden Partei nicht genehmen Sinne bespricht, gleich als Anwalt materieller Interessen und als Söldling hinzustellen. So einfach liegen die Dinge denn doch nicht! Freilich, es mag einer regierenden Partei bequemer sein, einen entzückten Trabantenchor um sich zu haben, der jeden Regierungsakt als Ausfluß der Unfehlbarkeit und der höchsten Weisheit preist. Aber erstens wäre mir vor solchem Unfehlbarkeitsdünkel bange, und zweitens gefiele mir ein Enttäuschter immer noch besser als jene republikanischen Franzjosefsritter, die eben erst die After der letzten Habsburger verlassen, um heute bereits, die phrygische Mütze auf dem gelockten Haupt, die neuen Herren zu umbuhlen.
Ja, ich gestehe es offen ein, warum ich und viele mit mir „enttäuscht“ sind: wir haben vielleicht zu viel erhofft, uns war so mancher der heute führenden Männer mehr als der Anwalt einer Partei und Klasse; wie die „Arbeiter-Zeitung“ im alten Österreich die beste Stütze des Protests gegen jedes Unrecht, gegen jede Knechtschaft und ein Hüter der Geistigkeit gewesen, so sollte, vermeinten wir, die Sozialdemokratie auch als Herrscherin, über ihr ökonomisches Programm hinaus, geistige Aufgaben nicht vergessen. Will man mir darauf sagen, daß dies „bourgeoise Naivität“ sei, daß die Sozialdemokratie nur eine Aufgabe, die Herrschaft des Proletariats, zu erfüllen habe, dann werde ich mich damit bescheiden. Den Schluß auf die Möglichkeit einer Demokratisierung der Gesellschaft mag dann jeder einzelne selbst ziehen. Aber davon abgesehen, würde diese Verengung des Programms an sich noch nicht den Verzicht auf Geistigkeit zur Folge haben müssen. Hier aber kommt man eben auf den wunden Punkt, den die Sozialdemokratie nicht eingesteht, daß sie in außerökonomischen Dingen nicht nur nicht aufs Ganze geht, sondern aus Rücksicht auf Spießerinstinkte, die in den Massen vorhanden sind, geistig versagt.
Warum – um nur ein Beispiel zu erwähnen – verhält sie sich feig in der Frage der Sexualknechtschaft; warum wagt sie nicht, in der Prostituiertenfrage menschlich und frei zu denken? Ist es wirklich damit abgetan, wenn man die gemeine Polizistenjagd auf die Prostituierten mit Witzen über die „Huldinnen der Schieber und Spieler“ abtut? Ich weiß, was man mir in diesem Punkt sagen wird, und bin darauf gefaßt, nächstens zu hören, Herr Karl Tschuppik sei der Ex-offo-Verteidiger der Kärntner Straße geworden. Mir aber graut mehr vor der Sittlichkeit mitregierender Spießerinnen als vor dem gehetzten Wild, auf das die um Staatsschutz und Volkswehr vermehrte Polizei des republikanischen Wien allabendlich Jagd macht. Und was ist’s mit der Gleichstellung der unehelichen Mutter, was mit der Befugnis der Schwangeren, über die eigene Frucht zu verfügen, was mit der Befreiung der Invertierten? Die ein Jahr alte Republik hat auf außerökonomischem Gebiet nichts hervorgebracht als eine kleine Änderung gewisser Strafrechtsparagraphen, die aber auch nur hinausläuft, den viehischen Hochverratsbegriff aus dem Schwarz-Gelben ins Rote umzufärben. Und darüber sollen wir entzückt sein!
Nun freilich habe ich noch etwas verbrochen. In dem zweiten der inkriminierten Artikel, der vieles sonst Unverständliche auf die Hysterie der Zeit zurückzuführen suchte, sagte ich unter anderem auch, daß sich viele nützliche Energie in einem kleinlichen Kampf gegen die bürgerliche Presse erschöpfe. Meine Behauptung, daß man daran denke, die Arbeit der bürgerlichen Presse unter die Kontrolle von Arbeiterräten zu stellen, bezeichnet die „Arbeiter-Zeitung“ als böswillige Erfindung. Es ist wahr, der Gedanke ist nicht weiterverfolgt worden, aber er war da und kam in einer gemeinsamen Sitzung der Verleger und Arbeiter zur Sprache. Aber das war’s ja nicht allein, was ich mir zu bekritteln erlaubte; ich meinte und meine auch heute noch, daß mit Gewalt, mit Unterdrückung und Reglementierung auch in Sachen der Presse nichts besser gemacht werde. Ich habe niemals vor den Fehlern und Mängeln der bürgerlichen Presse die Augen verschlossen, ja, es ist gewiß, daß die Wiener Blätter ein gerüttelt und geschüttelt Maß von Schuld haben an der großen Katastrophe, die von Wien aus ihren Anfang nahm. Aber da man ja sonst eine Festigung des Verantwortlichkeitsgefühls anstrebt und den Gedanken der „übermenschlichen Schuld“ mit Recht von sich weist, da man Politiker und Generäle vor einen Staatsgerichtshof zu stellen entschlossen ist, wäre es nur gerecht, vor den Journalisten nicht Halt zu machen, sondern auch sie nach den Schuldigen zu fragen. Ja, es könnte als Gewinn einer üblen Erfahrung die Institution von Pressegerichtshöfen geschaffen werden, die darüber zu wachen hätten, daß nicht jeder unverantwortliche Mensch Unheil anstiftet. Aber auf keinen Fall wird es gelingen, die Presse wieder zu einem tauglichen Instrument der Gesittung zu machen, wenn man sie drangsaliert oder bureaukratisiert.
Ich meine, daß ich nichts verschwiegen habe, was mir die „Arbeiter-Zeitung“ als Merkmal der Verspießerung vorhält und was ihr als typischer Fall des Abrückens von Geistigkeit und Demokratie erscheint. Wenn die Treue zur Demokratie nur darin bestehen soll, sich in einen Offiziosus zu verwandeln, der alles gutheißt, was oben geschieht, dann will ich lieber der „verärgerte Spießbürger“ sein als einer jener gesinnungstüchtigen Revolutionäre, die, gestern noch kaiserliche Räte, heute die Wiener Lobposaunen blasen.
[Prager Tagblatt, Jg. 44, Nr. 260, 6.11.1919, Morgen-Ausgabe, S. 1‑2 (Karl Tschuppik).]
[Redaktionelle Nachbemerkung]
Der Artikel der „Arbeiter-Zeitung“, gegen den sich unser Wiener Redakteur zur Wehr setzt, behauptet folgendes: „Während des Krieges unterschied sich das ,Prager Tagblatt‘ zu seinem Vorteil von der übrigen deutschbürgerlichen Presse: es bekämpfte mit Ernst und Nachdruck die damals marktgängige deutsche Politik, die von der Gunst der Regierung nationale Vorteile erhoffte und ihre Sache auf Patente und Ordonnanzen gestellt hatte. Die Haltung war wesentlich das Verdienst Karl Tschuppiks, der sich aus einer sozialdemokratischen Vergangenheit demokratische Gesinnung gerettet hatte. Herr Tschuppik ist nun nach Wien gekommen; hier ist er bald und gründlich verdorben worden. Nach einem kurzen Zwischenspiel bei Herrn Karpeles wirkt er wieder im ,Neuen Wiener Tagblatt‘; und der Geist Siegharts schwebt über ihm. Er schreibt jetzt, was dem Spießbürger gefällt. Und was gefällt jetzt dem guten Bürger? Das Schimpfen auf die Sozialdemokratie! Herr Tschuppik liefert es in dem ,Prager Tagblatt‘ – seine Wiener Artikel können wir nicht agnoszieren – in trefflicher Weise. Daß er das Schimpfen mit demokratischen Phrasen verbrämt, zeigt, daß er noch das Bedürfnis nach einem Alibi hat; aber die Verbrämung täuscht nicht über die Absicht.“
Zu diesen persönlich gehässigen Anschuldigungen möchten wir bemerken, daß die „Arbeiter-Zeitung“ das Kompliment und den Tadel, die sie uns widmen, mit mehr Recht auf sich selber beziehen kann. Sie war bis vor kurzem das beste Qualitätsblatt Österreichs, und nicht nur Österreichs, sondern weit darüber hinaus, solange sie von Fritz Austerlitz allein redigiert wurde. Seit dieser jedoch, wenn auch offiziell noch Chefredakteur, die unglückliche Politik Otto Bauers vertreten muß, ist aus der ausgezeichneten Zeitung, die auch jeder Nichtsozialist mit Respekt und Interesse lesen konnte, ein gewöhnliches offiziöses Schimpfblatt geworden, das jeden Journalisten mit giftigen, persönlichen Racheartikeln verfolgt, der die Politik Otto Bauers nicht kritiklos hinnimmt. Wenn die „Arbeiter-Zeitung“ in der Maßlosigkeit ihres Zornes noch die Grenzen erkennen könnte, die anständige Journalisten sich selber ziehen, so würde sie nicht unablässig einen politischen Schriftsteller wie Karl Tschuppik verunglimpfen, der bewiesen hat, daß er für seine politische Überzeugung Opfer auf sich nimmt. Das „Prager Tagblatt“ ist keine Ablagerungsstätte für die Gehässigkeiten der Wiener Politiker und Zeitungen untereinander, und was Tschuppik anbelangt, so hat er niemals auch nur den Versuch unternommen, die Politik irgendeines Wiener Zeitungsmagnaten hier zu vertreten.
Einmengung in eine Hotelrazzia
Herr Karl Tschuppik, der einmal sehr radikale politische Ansichten verfocht, sich aber dann im Zwinger des Bankpräsidenten Sieghart, dem „Neuen Wiener Tagblatt“, wohlbefand, hat von seinem Radikalismus nur eines behalten, die Abneigung gegen die Sittenpolizei, also das, was den Kapitalisten nicht wehtut. Dadurch zog er sich eine Anklage zu. Am 30. Jänner gegen 5 Uhr abends hatte nämlich die Polizei im Hotel „zum römischen Kaiser“ und im Hotel Wieser eine Razzia nach unkontrollierten Prostituierten vorgenommen. Im Hotel „zum römischen Kaiser“ wurde ein Mädchen unter dem Verdacht der geheimen Prostitution angehalten. Sie sollte von dem Kriminalinspektor Robert Hanisch dem Polizeirat Dr. Haucke, der im Hotel Wieser amtierte, vorgeführt werden. Als der Kriminalbeamte mit dem Mädchen vor das Hotel Wieser kam, rief eine elegant gekleidete Frauensperson, die den Kriminalbeamten und die Arretierte für ein Liebespaar hielt, zu, er solle jetzt nicht mit dem Mädchen ins Hotel gehen, da hier eine Razzia stattfinde. Der Kriminalbeamte hielt deshalb auch die Ruferin für eine Prostituierte und arretierte auch sie. Sie soll, wie die Polizei erklärt, unter dem Verdacht der geheimen Prostitution stehen. Die zweite Arretierte wollte flüchten, wurde aber vom Kriminalbeamten festgehalten. Sie wollte sich dem Kriminalbeamten entwinden und stieß laute Hilferufe aus. Dadurch lenkte sie die Aufmerksamkeit der Vorübergehenden auf sich, zu denen auch Herr Tschuppik gehörte. Als der Kriminalbeamte die Arretierte mit beiden Händen hielt und sie, mit ihr förmlich ringend, in ein Haustor drängte, folgte ihm Tschuppik nach, und nun soll er den Beamten an der Amtshandlung zu hindern gesucht haben. Tschuppik wurde nun gleichfalls arretiert. Als auf Verlangen Tschuppiks Polizeirat Dr. Haucke herbeigeholt wurde, soll Tschuppik gesagt haben: „Es zeugt von merkwürdigen Sitten, wenn dieser Mann (Kriminalinspektor Hanisch) eine wehrlose Frau auf der Straße überfällt.“ Tschuppik bekam nun eine Strafverfügung wegen Wachebeleidigung und Einmengung in eine Amtshandlung. Er wurde zu zehntausend Kronen Geldstrafe verurteilt.
Da er gegen die Strafverfügung Einspruch erhob, mußte eine öffentliche Verhandlung angeordnet werden. Der Angeklagte erklärte, daß er in dem Manne, der die Frau auf der Straße derart behandelte, keine Amtsperson vermutete, sondern geglaubt habe, daß ein Trottel von eifersüchtigem Ehemann seiner Frau auf der Straße eine Szene mache oder daß ein Strolch sie überfallen habe. Er habe deshalb dem Manne zugerufen: „Lassen Sie doch die Dame aus!“ Vor Polizeirat Dr. Haucke habe er die Äußerung gemacht, und er habe sich als Publizist berechtigt gefühlt, diese Kritik zu üben. Die Frau, die auf diese Weise behandelt wurde, habe keineswegs den Eindruck einer Kokotte gemacht. – Kriminalinspektor Hanisch erklärte als Zeuge, vor Tschuppik habe er sich erst nach dessen Ruf als Kriminalbeamter legitimiert.
Der Richter Landesgerichtsrat Dr. Fryda sprach den Angeklagten von der Einmengung in eine Amtshandlung frei, weil die Verantwortung, er habe den Amtscharakter des Kriminalinspektors zur Zeit der Einmengung noch nicht gekannt, nicht mit Sicherheit widerlegt sei. Hingegen wurde der Angeklagte wegen Wachebeleidigung zu vierzigtausend Kronen Geldstrafe verurteilt. – Dazu ist zu bemerken, daß es eine juristische Streitfrage ist, ob der Richter berechtigt ist, in der Verhandlung eine höhere Strafe zu verhängen als in der Strafverfügung. Das Gesetz schließt es nicht ausdrücklich aus.
[Arbeiter-Zeitung, Jg. 34, Nr. 301, 9.11.1922, Morgenblatt, S. 6-7 (ohne Signatur).]
Mein Prozeß
Vor einigen Tagen war ich Zeuge einer kleinen Szene, die sich um die Mittagsstunde auf dem Stephansplatz abgespielt hat. Ich kam gerade dazu, als ein Wachmann ein etwa dreizehnjähriges Mädchen festhielt und dessen Namen nebst Adresse abverlangte. Das Mädchen, fast noch ein Kind, weinte vor Scham und Angst und weckte dadurch die Aufmerksamkeit der Passanten, von denen einige stehengeblieben waren, um sich nach der Ursache dieser auffallenden Amtshandlung zu erkundigen. Was hatte das weinende Kind verbrochen? War es beim Straßenbettel ertappt worden, hatte es gestohlen oder sich sonst eines Vergehens schuldig gemacht? Der Wachmann, das Notizbuch in der Hand, war nicht geneigt, auf die neugierigen Blicke und Fragen Antwort zu geben. Erst als ein älterer Herr in respektvoll-wienerischer Tonart, sozusagen als Anwalt aller Neugierigen, sich zu fragen erlaubte: „Herr Wachmann, was hat denn das Kind ’tan?“ – erst da ließ sich der Polizist herbei, eine Antwort zu geben. „Schau’n S’ an, wie der Fratz umanandrennt.“ Alle Blicke richteten sich auf das Mädchen, das noch immer weinend neben dem Schutzmann stand. Nun, das Kind war nicht wie ein Mädchen, sondern wie ein Bub gekleidet; es trug eine kurze Hose, grüne Strümpfe und einen Wolljanker nach der Art der Touristen, wie man sie im Sommer, bei Ausflügen im Wienerwald, bei Buben und bei Mädchen zu Tausenden sieht. Es war, ohne das Kind zu befragen, auf den ersten Blick klar, wie es zu diesem Kleid gekommen sein mochte: dem armen Mittelstandsmädel waren die Mädchenkleider zu eng oder sie waren sonstwie unbrauchbar geworden; an Reservekleidern aber besaß es offenbar nichts anderes mehr als diesen Ausflugsanzug aus besseren Tagen. Möglich, daß er dem Bruder gehört hatte. Die Beteuerung der Weinenden, sie müsse die Hose tragen, die Mutter gebe kein anderes Kleid, bestätigten diese Annahme.
Die Leute, welche die Szene mitangesehen, nahmen für das Mädchen Partei; die Mehrzahl redete dem Wachmann in der nettesten Wiener Form zu, das Mädchen freizugeben und kein Aufsehen zu machen. Nur ein Herr, etwas temperamentvoller als die anderen, sagte erregt einige heftige Worte. Ihm hatte das Mädchen seine Freilassung zu danken; der Wachmann wandte sich dem Erregten zu, eine neue Amtshandlung vor Augen. Das Mädchen lief davon. Ich hatte mich, nicht ohne innere Überwindung, zurückgehalten. Denn ich kam von der Verhandlung beim Bezirksstrafgericht, wo ich eben wegen Amtsehrenbeleidigung zu vierzigtausend Kronen beziehungsweise zu drei Tagen Arrest verurteilt worden war.
Ich erzähle diese kleine Szene, weil an ihr zweierlei deutlich wird: erstens einmal der neue Geist unserer republikanischen Polizei, zweitens aber die Tatsache, wie leicht sich „Einmischungen“ in „Amtshandlungen“ und „Amtsehrenbeleidigungen“ ergeben. Im vorliegenden Falle hat nicht das kleine Mädel, sondern der Wachmann Ärgernis erregt; es war einfach aufreizend und empörend, zusehen zu müssen, daß ein Polizist, der für die Sicherheit der Straße zu sorgen hat, sich das Recht anmaßen darf, ein armes Mädel anzuhalten und zu beschimpfen, weil es eine Tracht trug, die dem Manne nicht gefiel. Nur einem Narren oder einem krankhaft Veranlagten hätte einfallen können, an dem Anzug des Mädchens etwas „Anstößiges“ zu finden; dem normalen Menschen fiel es überhaupt nicht auf. Die Anwälte der Ordnung, wie die Verfechter unserer großartigen Freiheiten werden wahrscheinlich erwidern, ein solcher Vorfall sei eine Bagatelle, die Entgleisung eines Wachorgans, die nichts beweise. Wer jedoch gewöhnt ist, das Maß der menschlichen Freiheit nicht nach dem Verbrauch politischer Phrasen, sondern nach den kleinen Dingen des Lebens zu beurteilen, der wird daraufkommen, daß diese Wiener „Einzelfälle“ keine Ausnahmen, sondern Merkmale eines Polizeigeistes sind, der darum nicht besser wird, weil ihn nicht der alte Obrigkeitsstaat, sondern ein republikanisches Spießerregime ausstrahlt. Und dieses Spießerregime hatte ich an einem seiner heikelsten Punkte verletzt.
Mein Fall war sehr einfach: Ich kam eines Tages an einem Straßenskandal vorbei, den ein Zivilwachmann hervorgerufen hatte. Ich hörte eine Frauenstimme um Hilfe schreien, sah, ohne zu ahnen, warum sich’s handelt, einen schweren Klachel mit einer Frau ringen und versuchte der Frau beizustehen. Der Ringer entpuppte sich als Konfident; die von ihm überwältigte Frau hatte das Verbrechen begangen, ein Paar, das durch die Wallnerstraße ging, vor der Hotelrazzia zu warnen, die zur selben Zeit von einer Polizeipatrouille inszeniert worden war. Das sogenannte Sittenamt erhob gegen mich die Klage wegen „Einmischung in eine Amtshandlung“, überdies aber auch wegen „Amtsehrenbeleidigung“, weil ich dem amtierenden Kommissär, die mildeste Form der Kritik wählend, gesagt hatte: „Es zeugt von merkwürdigen Sitten, wenn dieser Mann (der Konfident) eine wehrlose Frau überfallen darf.“
Ich will hier nicht auf jenes Thema eingehen, welches dem Wiener Sittenamt den sachlichen Vorwand zu seiner Praxis gibt; ein ernsthafter Mensch dürfte sich heute mit der Behauptung überhaupt nicht mehr ans Licht wagen, daß mit der Jagd auf Straßenmädchen irgend etwas zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten getan sei. Die Syphilis läßt sich nicht vor den Liebeshotels arretieren, sie läßt sich überhaupt nicht arretieren. Die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten gehört nicht in das Ressort der Polizei. Wo es der Gesellschaft und dem Staate damit wirklich ernst ist, dort findet man auch den selbstverständlichen Weg der Heilung. Man braucht sich in diesem Punkte nur die Tschecho-Slowakei als Beispiel zu nehmen; dort ist die gemeine, unmenschliche Art der Kontrolle radikal beseitigt und die Einmischung der Polizei abgeschafft worden. Das Volksgesundheitsamt aber bereitet ein Gesetz vor, das jedem Erkrankten den ihm frommenden Zwang zur ärztlichen Behandlung auferlegen wird. Hier haben wir den Unterschied zweier Polizeimaßregeln: in der Tschecho-Slowakei faßt man das Problem sachlich an, hebt es aus dem Sumpf der Spießermoral und übergibt es dem Arzt; der humane, moderne Staat übt seine Gewalt in erziehendem Sinn. Die Spießerrepublik Österreich hat gar nicht den Mut, in dieser Sache das Licht der Sachlichkeit anzuzünden; sie läßt die Frage absichtlich im Dunkel. Wie sich der Spießer als Einzelperson nicht getraut, das Ding beim richtigen Namen zu nennen, weil er in den wichtigsten Lebensdingen unfrei ist, so wagt sich auch sein Staat nicht an die Frage heran. Es ist wie dem Einzelspießer, so auch dem Spießerstaat nicht um die Volksgesundheit, sondern um seine Moral zu tun; die Syphilis wird hinter dem Rücken der Öffentlichkeit auf den Privatweg verwiesen. In der Öffentlichkeit aber pflanzt man die Fähnlein „Hygiene“ und „Sittenamt“ nur auf, um ungenierter die Spießerinstinkte austoben lassen zu können: den Haß gegen die geschlechtliche Freiheit, die infernalische Wut gegen alles, was die Unfreiheit, Befangenheit und Feigheit des Spießers tangiert. Man könnte an das Gewissen des christlichen Priesters Dr. Seipel appellieren und ihn fragen, ob er nicht einer polizeilichen Praxis Einhalt gebieten will, die Wien zur Schande gereicht; man könnte fragen, ob nicht auch in der angeblichen Kulturstadt Wien zu erreichen wäre, was in der Stadt des humanen und edlen Präsidenten Masaryk möglich geworden. Aber ich weiß, daß jede humane, christliche Absicht auf den Widerstand der Spießerinstinkte stoßen wird. Der Spießer – ob politisch radikal oder reaktionär, ist in diesem Falle ganz gleich – hat keinen Sinn für freies Menschentum, er versteht unter „Freiheit“ nur die politisch angestrichene, die parteimäßig gestempelte Phrasenfreiheit, nicht aber die Freiheit im Menschlichen und im Denken.
Die „Arbeiter-Zeitung“ war so liebenswürdig, mir in ihrem Prozeßbericht zu sagen, ich wähle den Kampf gegen die Sittenpolizei gewissermaßen als eine bequeme Art des Radikalismus, weil er den Kapitalisten, in dessen „Pressepfuhl“ ich mich wohlfühle, nicht weh tut. Dieser Vorwurf ist sehr billig; ich weiß nicht, was ein „Pfuhl“ ist, ich weiß nur, daß es ein unabhängiger Mensch in Wien ungeheuer schwer hat, seine Meinung zu sagen. Und dies umso schwerer, wenn er außerhalb jener Front steht, die alle Spießer vereint, nicht nur jene der „politisch koalierten Bourgeois“, sondern auch die der „klassenbewußten Proletarier“.
[Wiener Sonn- und Montags-Zeitung, Jg. 60, Nr. 44, 13.11.1922, S. 4 (Karl Tschuppik).]