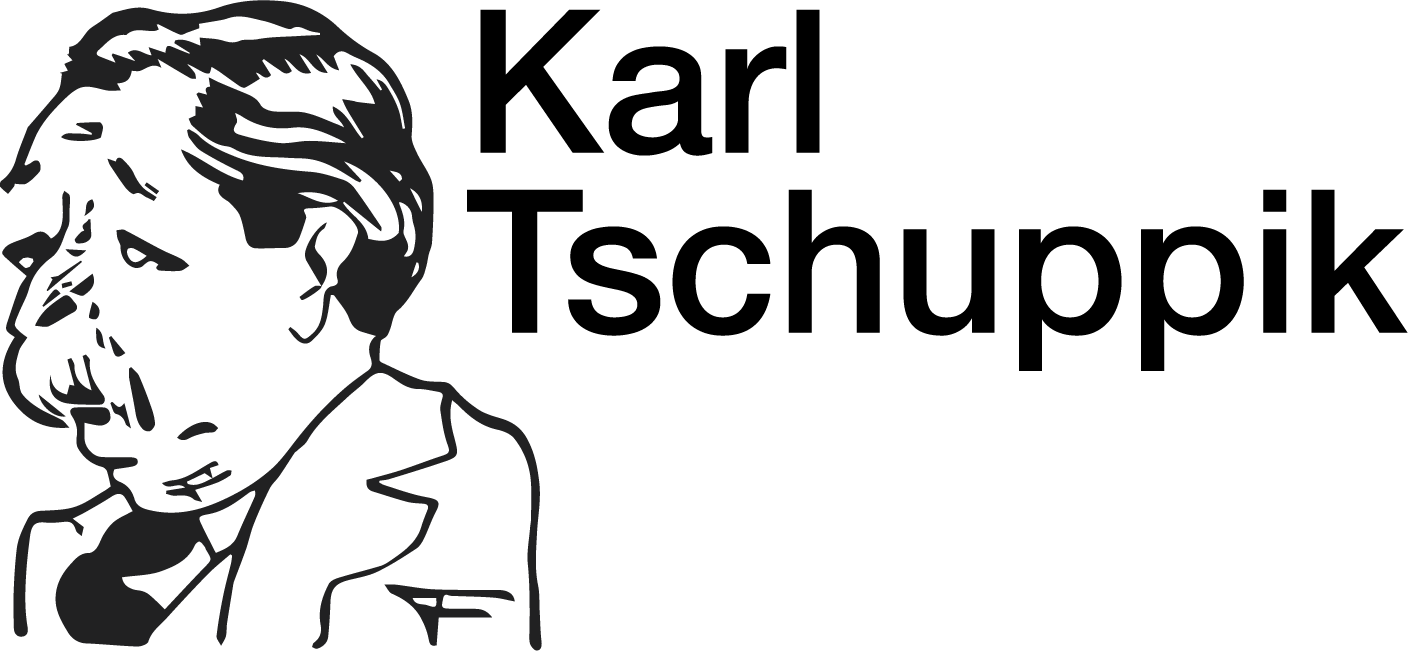Geplanter Erscheinungstermin des „Journalistischen Werks“ ist Herbst 2027. Bis dahin, als Platzhalter gleichsam, eine Hand voll Texte Karl Tschuppiks aus allen Lebensphasen.
Literatur und Politik
Bureaukraten, Pensionisten, Reserveofficiere, Staatsanwälte und alle sonstigen Lebewesen, die mit düsteren Mienen und schweren Seufzern die Politik verfolgen und überall Gefahren und Umsturz wittern, sie alle sollten eigentlich recht froh und lustig sein. Denn niemals waren wir im Österreicherthum so mitten drin wie eben jetzt. –
Eine Regierungspolitik, deren hervorragendstes Merkmal es ist auf künstliche Art Konflikte zu schaffen, den lammfrommen Biedermaiern Rauflust einzuflössen, die Köpfe der braven Leute recht duselig zu machen, um ja einer jeden ernsteren Aufgabe aus dem Wege zu gehen – was ist das für eine Politik? Eine österreichische!
Die reichsfeindliche Partei der grimmigen Hussiten aus der Mariengasse, die sonst im Zähnefletschen den bösen Löw’ übertrumpfen wollte und jetzt zum Scharwenzeln dessen Doppelschweif und noch einen dazu gebrauchen könnte – diese brave, demüthige, salonfähig gewordene Opposition, die Fusstritte rasch vergisst und sie heute als Liebkosung empfindet, die der schneidigen Polizei Triumphe bereitet, das ist doch gar nichts anderes als eine österreichische Partei.
Und die fuchsteufelswilden deutschen Herren, deren Wortschwall das Laub der deutschen Eiche zittern macht?
Erschrecken sie nur nicht, es ist nicht so gefährlich, man muss sie kennen, man muss sie gesehen haben bei ihren Schützenfesten, Turnereien und sonstigen feuchtfröhlichen Veranstaltungen, am Bierfass oben, die erhobene Rechte zum Schwur bereit und dann abends ganz gemüthlich wieder im engen Kreis beim süffigen Pilsner und das deutsche Lied … Heilô, trara, trara … Auch das ist nicht so schlimm. Die Deutschen sind halt bischen romantisch. Und man muss das öde, graue Dasein verschönern. Ein jeder will seinen bunten Lappen haben, der ihm Freude macht.
Auch das ist ja echt österreichisch, diese Liebe fürs Decorative. Der Makartismus sitzt uns im Blut. Regierungspolitik, Parteipolitik, Badeni, Březnovský und Funke, überall scheint eine geheime Kraft von einem Mittelpunkt auszugehen. Wenn das so fortgeht, werden wir das stylvollste Land der Erde!
Und wahrhaftig, auch die Kunst kann sich dieser mystischen Macht nicht entziehen, sie muss dem allgemeinen Gravitationsgesetz folgen. Nach langem Mühen – wo man nicht recht wusste, was diese Wiener Literatur eigentlich sei – hat sich der Erfolg gemeldet: unsere moderne Literatur, die zu den Franzosen in die Schule gieng, auch von Italien, weniger vom Norden, manche Anregung empfangen hat, aus Japan die naive Einfachheit der Mittel importirt, sie ist eben auch österreichisch. Die dummen Leute des blossen Verstandes knurren wieder so etwas von Impotenz, die sich hinter diesem „österreichisch“ verstecke, aber man darf darauf nichts geben: ihnen fehlt jener Gehirntheil, der die Fähigkeit besitzt, geistreichen Unverstand zu produziren.
Ist man aber einmal so weit, den „blossen Verstand“ überwunden zu haben, dann erst gehen einem die wahren Wunder moderner Kunst auf. – Oskar Panizza hat einmal den Nachweis zu erbringen versucht, dass in der modernen Kunst ein grosser Einfluss des Varietés zu finden sei. Dies scheint in erster Linie für Österreich Giltigkeit zu haben. – An Stelle des Interesses für ernstere Probleme tritt ein Fangballspiel mit tausend Fragen zugleich und ist auch dies abgethan, dann erscheint man in der neuen Blasirtheit um so interessanter.
Lustige Münchhausiaden, für den Theetisch zugestutzt, so gerade recht, um das Entzücken müder Mädchen wachzurufen, und harmlose Betrachtungen, in nette Worte gekleidet, füllen die Bücher.
Der Spiegel ist die unerschöpfliche Quelle neuer Anregungen geworden, und seit dem Venedig in Wien, ist an Stoff kein Mangel.
An dieser lustigen Faschingspoesie lässt sich nun einmal nichts ändern. Eine Literatur, die an allen tiefergreifenden Fragen der Zeit ohne Notiz vorbeigeht, die zum Leben gar keine Beziehungen mehr hat, im Volk kein Echo findet, sie ist mit ihren geschniegelten, verschnörkelten und bizarren Formen, wie ein nervöser Traum, ein täuschender Wahn, dem die Ernüchterung folgen muss.
Von den Vertretern einer blossen Musik der Worte, die ohne den Ernst und die Würde der grossen Kunst ist, kann man keine Thaten erwarten.
Aber auf eines wenigstens hätte man bei all dem verrenkten Gefasel von Kultur nicht vergessen sollen, auf die beschämende Bevormundung des gesammten österreichischen Schriftstellerthums, auf die immer noch nicht beseitigte Censur der Presse.
Über diese desperate Einrichtung viele Worte zu verlieren, das ist unnöthig.
„Die Freiheit der Presse oder mit anderen Worten: die volle Freiheit der Gedankenäusserung durch Rede, Schrift und Bild ist eine der grossen politischen Fragen, die seit dreissig Jahren die ganze gesittete Welt beschäftigen und bewegen, an deren befriedigende Lösung die höchsten Interessen der jetzt lebenden und der kommenden Geschlechter geknüpft sind … Es ist eines der politischen Axiome geworden, die in unseren Tagen keines weiteren Beweises mehr bedürfen, dass in repräsentativen Staaten die Presse frei sein und die Äusserung des Gedankens durch Schrift und Bild keiner vorhergehenden Censur, die jeden möglichen Missbrauch in Polizeiwegen zuvorkommend abwehren will, mehr unterworfen sein soll.“ – So sprach der badische Ministerialbeamte Freiherr von Liebenstein im Jahre 1819!
Aller Länder Regierungen haben dieser Forderung nachgegeben, nur wir sind am alten Fleck und die Regierung hat keine Ursache, den Literaten etwas zu schenken, das sie nicht erzwingen.
Aber es scheint, dass ein Bedürfnis nach Pressfreiheit in dem bürgerlichen Schriftstellerthum gar nicht vorhanden ist. Artistische Kunststückchen, sexuelle Phantasien werden nicht konfiscirt, warum also sollte man sich aus der Ruhe bringen lassen?
Aber erinnern wir uns: selbst in Österreich gab es einmal andere Zeiten, wo in der Literatur Politik zu spüren war. Glänzte nicht Grillparzers Name als erster auf der Petition der Wiener Schriftsteller und Journalisten vom 11. Mai 1845?
Heute würde man über die bescheidenen alten Herren spöttisch lächeln, nur der Muth dieser alten Herren wäre nirgends zu finden. Damals war ein Solidaritätsgefühl unter den österreichischen Schriftstellern und ein jung aufstrebendes Bürgerthum bot neuen Forderungen Rückhalt.
Die heutigen Bürgerparteien aber sind unfähig geworden, dem Fortschritt, den sie stets im Munde führen und den sie in Misskredit gebracht, auch nur den kleinsten Dienst zu erweisen. Ihr einziges Interesse läuft darauf hinaus die Stabilität ihrer Existenz nicht aus dem Gleichgewichte zu bringen.
Dieselbe beklemmende Starre des bürgerlichen Lebens, dieselben Possenreissereien der bürgerlichen Politik weist auch die Literatur auf.
Die primitivste Forderung, die Mündigkeitserklärung der Presse zu erkämpfen, auch dieses bleibt dem Proletariat überlassen, das auch zur Bekämpfung der Theatercensur den ersten Stoss gab.
Aber die Scham sollten sie wenigstens lernen unsere Literaten, die Scham vor ihren fremdländischen Collegen im civilisirten Europa: die einzigen zu sein, denen es noch nicht gelungen ist ihr Gängelband zu durchschneiden.
[Akademie. Orgán socialistické mládeže / Organ der socialistischen Jugend, Jg. 1, Nr. 8, August 1897, S. 358-360 (Karl Tschuppik).]
Zum Austritt der Künstlerkommission
Prag wird bekanntlich seit einiger Zeit zur Grossstadt umdemolirt. Die ganze untere Altstadt soll umgestaltet werden, zahlreiche und schwierige, bautechnische und architektonische Probleme gilt es zu lösen. Dass es bei dieser Gelegenheit nicht ohne die üblichen Reporterklagen abgeht, die im Jammerton den Untergang dieses oder jenes der alten Häuser beklagen, ist selbstverständlich. Gegenüber dieser Art von sentimentaler Reliquienverehrung könnte sich das Recht der Lebenden schon behaupten, wenn nicht ein besonderer Umstand zur Vorsicht mahnen würde. Prag gehört zu jenen wenigen Städten, die wie z. B. die alten Reichs- und Hansastädte noch aus der Zeit ihrer Blüte, wenn nicht einen ausgesprochenen architektonischen Charakter, so doch zahlreiche Kunstwerke besitzen. Die alten Reichs- und Hansastädte haben die Epoche ihrer wirtschaftlichen und damit künstlerischen Blüte längst überlebt, sie wachsen heute nur langsam an und der architektonische Charakter der Stadt erscheint wenig nur gefährdet. Prag dagegen ist in einem verhältnismässig kurzen Zeitraum sehr angewachsen, das Wachsthum der Bevölkerung, die Umgestaltung des gesellschaftlichen Lebens, erfordert auch eine Umgestaltung der Stadt. Dass bei modernen Stadtanlagen und Erweiterungen der Standpunkt des Ingenieurs nicht allein massgebend sein kann, steht ausser Zweifel. Von den vielen Aufgaben des Städtebaues ist unzweifelhaft die Architektur der Strasse eine der ersten und wichtigsten. Schon deshalb, weil sie uns auf Schritt und Tritt verfolgt. Die Frage ist aber auch eine der schwierigsten und wurde bis heute nicht genügend berücksichtigt. Erst in den letzten Jahren ist man davon abgekommen ganze Städte mit Schiene und Winkel vorzuzeichnen. Verhältnismässig leichter gestaltet sich die Aufgabe in Städten, die einen gewissen Styl besitzen. Hier kommt das Frühgeschaffene dem Architekten zu Hilfe, es bietet ihm Anknüpfungspunkte. Namentlich, wenn, wie in Prag, der zu erbauende Stadttheil an historische Plätze und Gebäudegruppen grenzt. Selbstverständlich ist innerhalb dieses Rahmens dem Architekten die grösste Freiheit geboten. Dies haben in Prag eine Anzahl Künstler eingesehen und es sich zur Aufgabe gemacht, der künstlerischen Entwicklung der neuen Strassen und Plätze die Wege zu weisen. Der Prager Stadtrath aber ist anderer Meinung. Er will den Künstler nicht hören; der Architekt soll schweigen. Nur der Ingenieur, ja vielleicht nur der Maurermeister soll entscheiden! Der Zinsbarackenbauer und Spekulant, dessen stumpfer Sinn nur auf die Hauszinsteuer gerichtet ist. So geschah das Unerhörte, dass die Prager Künstlerkommission ganz verdrängt wurde von der Mitarbeit und um keinerlei Verantwortung zu tragen an der Verpfuschung der Stadt, traten die Künstler lieber ganz zurück.
Diese Handlungsweise des Prager Stadtraths spricht für sich. Es scheint beinahe, als ob den Prager Stadtvätern die Weinberge – dieses fadeste und langweiligste Stadtbild – als Ideal einer modernen Stadt vorschweben würde.
Obzwar einige Aufgaben schon gänzlich misglückt sind – ich verweise blos auf die neue Markthalle, deren Anlage und Ausführung eine vollkommen verfehlte zu nennen ist – verschmäht der Prager Stadtrath dennoch die Mitarbeit von Fachleuten und Künstlern.
Am Altstädter Platz steht bereits ein Koloss, der auf das Ärgste vorarbeitet. In jeder anderen Stadt würde man gegen die Verunstaltung eines solchen Platzes protestieren; in Prag scheint man es darauf abgesehen zu haben, den Charakter dieses Platzes nur recht zu kompromittiren und bestreicht das Zinshaus mit einer recht eindringlichen gelben Tünche.
Die Verwaltung einer modernen Grossstadt hat nicht allein die Verpflichtung Mietskasernen und Viehhöfe zu bauen; wenn sie die Gebote der Architektur und Kunst unterdrückt, dann versündigt sie sich an der Entwicklung der Kunst im Volke.
Man vergesse nicht, dass die Architektur die sichtbarste aller Künste ist, dass sie den besten Massstab giebt zur Beurtheilung der Kultur eines Volkes!
[Akademie. Orgán socialistické mládeže / Organ der socialistischen Jugend, Jg. 2, Nr. 7, April 1898, S. 327‑329 (K. T.)]
„Unser Theater“
Wien, du hast es besser! Schlenther wird gehen und – Neumann bleibt. Das ist die erste und natürlichste Empfindung, die sich uns armen Pragern aufdrängt, wenn wir von der Krisis der Wiener Hofbühnen hören. Jawohl, die Geduld dieses braven Wiener Publikums, das Jahre lang alle Sünden wider den heiligen Geist seiner alten Kunststätte ruhig hinnahm, ist doch endlich gerissen, die artige, brave Kritik, mit welcher man der vielen Vergehen gegen den guten Geschmack und die Tradition der Burg begegnete, hat sich in eine offene Opposition verwandelt, und dort, wo man früher höchstens achselzuckend seufzte: „Schade um das Burgtheater!“, schreit man jetzt aus vollen Lungen: „Hinaus mit Schlenther!“
Wahrhaftig: Wien, du hast es besser! Und doch wäre auch in Prag die höchste Zeit, daß man sich ernstlich unseres Theaters besänne, daß man wieder begreifen lernte, was es war und was es sein könnte. Während unsere Bühne, die einstmals der Stolz der Deutschen dieser Stadt war, alle sichtbaren Zeichen des Verfalls aufzeigt, hat ihr Leiter, Direktor Angelo Neumann, nichts Besseres zu tun, als Pläne für sein Jubiläum zu schmieden. Wir wollen ihn in dieser Arbeit vorläufig nicht stören, umso energischer aber werden wir fortfahren, unser Publikum daran zu erinnern, daß es seinen besten Besitz, das Deutsche Theater, zu schützen hat. Und das wird nachgerade eine dringende Angelegenheit. Das Publikum muß einmal ganz offen und so laut als möglich zu verstehen geben, daß es mit dieser Art Theater nicht mehr so weitergehen darf, daß es sich die Abspeisung, die ihm jetzt zuteil wird, nicht länger gefallen zu lassen gesonnen ist.
In einer andern Stadt, unter andern Verhältnissen wäre die Antwort auf die Neumannsche Theaterführung sehr einfach, indem man sagen könnte: Geht nicht mehr ins Theater! In Prag ist dieser Standpunkt ausgeschlossen. Nicht nur, weil diese Bühne unsere Bühne ist, nicht nur, weil im Deutschen Landestheater die ganze kulturelle und gesellschaftliche Kraft des deutschen Prag sich verkörpert, sondern vor allem deshalb schon, weil der Prager Deutsche das Theater braucht und auf es angewiesen ist. Er muß ins Theater gehen, er hat keine andere Wahl; er kann die freien Stunden des Tages nicht anders verbringen als im Theater. Das Theater soll ihn mit der Welt der großen Kultur in Kontakt erhalten, es ersetzt ihm aber auch den Salon, den Klub, das Vereinsheim. Wir brauchen das Theater. Das weiß der Direktor. Er weiß ganz gut, daß er stets sein Publikum finden wird, er weiß, daß, wie immer auch die Bühne beschaffen sein mag, der Prager Deutsche abonnieren muß. Und darauf pocht er, darauf baut eher. Diese Zwangslage des Publikums, das durch Bande der Liebe und der Notwendigkeit an das Theater gefesselt ist, nützt der Mann nicht nur aus, er deutet es als ein Zeichen seiner Macht. Das Publikum muß kommen, also bin ich allmächtig – diese Formel hat Direktor Neumann auf „sein“ Haus geschrieben. Und er gibt sich ganz wie ein König. Was „Er“ will, muß geschehen, was „Er“ diktiert, ist oberstes Gesetz, was „Er“ befiehlt, kann keine Macht der Welt umstoßen. Dieses Herrscherbewußtsein eines Theaterpaschas hat eine Art Theaterabsolutismus geschaffen, der strenger, härter und unerbittlicher ist als der Polizeiabsolutismus des Vormärz. Das Publikum ist ein Hund, der zu kuschen hat, das Publikum ist Pöbel, der die „Geschenke“ dankbar entgegennehmen muß und froh sein darf, wenn er für sein Geld die Neumannsche Herrlichkeit begaffen darf. Und der Absolutismus geht so weit, daß er dem Theater schon rein äußerlich den Stempel aufdrückt. Wie und wann zu applaudieren ist, das bestimmen der „König“ und seine Gemahlin aus ihrer Hofloge. In jedem andern Theater würde man solches Betragen taktlos finden; in Prag ist es ganz natürlich. Man hat sich so an die Formen des Neumannschen Absolutismus gewöhnt, daß man es für selbstverständlich hinnehmen würde, wenn Seine Majestät, der Herr Direktor, nächstens auch Cercle hielte.
Immerhin: Dieses „Theater im Theater“, dieses König-Spielen des Direktors brauchte nicht notwendig einen Verfall unserer Bühne herbeizuführen. Es gibt zwar ausgezeichnete Direktoren (man braucht nur an Reinhardt zu denken), die wirkliche Könige, wirkliche Leiter und Lenker sind, ohne der Tyrannen-Pose zu bedürfen, es gibt wirkliche Theater-Kaiser in der Form kleiner Kommis, aber man kann, sofern einer die alte Überlieferung der Meyerbeer-Opern und des Hermelinmanteltums à tout prix haben will, schließlich auch diesen Typus gelten lassen. Der Gestus macht ja schließlich nicht den Mann. Aber das Direktorentum Angelo Neumanns ist nur Gestus, ist nur Hermelinmantel. Der Mann dünkt sich ein König, aber er ist es nicht. Er war es vielleicht einmal. Heute aber weiß er vom Theater nicht viel mehr, als was man vor dreißig Jahren von einem Regisseur an Kenntnissen verlangt hat. Die große Entwicklung der deutschen Bühne in den letzten zwanzig Jahren ist an ihm spurlos vorübergegangen. Er hat keine Ahnung, worauf es heute im Schauspiel ankommt, er weiß weder ein Ensemble zusammenzusetzen noch abzustimmen, er weiß es nicht zu bilden und nicht zu erziehen. Seine einzige Kunst besteht darin, gelegentlich ein paar große Künstler hieher zu rufen und dazu die Reklametrommel tüchtig zu schlagen.
Es würde heute zu weit führen, wollte man die Art des Neumannschen Theaterspiels erschöpfend analysieren; dazu wird sich ja noch genug Gelegenheit finden. Aber notwendig ist’s schon heute, jenen Nimbus, den Direktor Neumann künstlich sich geschaffen hat, zu zerstören. Nicht als ob man Unmögliches von unserer Bühne fordern würde; wir wissen ganz genau, was man bei unsern Mitteln und unsern Kräften verlangen darf: Die Neumannsche Direktionsführung aber, diese veraltete Art des Bum-Bum-Theaters, ist heute direkt ein Hindernis für eine ersprießliche Weiterentwicklung unserer Bühne, sie ist ein Hindernis, an dem jeder Versuch einer Verjüngung und Gesundung scheitern muß.
Und hier kommen wir wieder auf das Königstum Neumanns. Die wirklichen Verdienste dieses Mannes, die rückwärts liegen und in der Theatergeschichte ihren gebührenden Platz finden werden, sollen durchaus ungeschmälert bleiben. Von ihnen aber führt kein Weg zur Gegenwart. Direktor Neumann hat vieles geleistet, aber er ist auf seinem Postament stehengeblieben. Sein Königsbewußtsein hat ihn daran gehindert, mit der Zeit fortzuschreiten. Ein anderer Direktor hätte einen modernen Regisseur gerufen, hätte sich belehren, überzeugen lassen; Direktor Neumann verträgt keine selbständige Meinung, er kann künstlerische Eigenart nicht vertragen und als Helfer nur Kreaturen brauchen, die, ihm willenlos ergeben, seinen Schwächen und Eitelkeiten schmeicheln. Er weiß Talente zu finden wie sobald niemand wieder, er weiß Begabungen zu entdecken, aber in der Führung der Bühne beharrt er eigensinnig auf seinen Anschauungen von anno Tobak.
Kommt noch ein Spezial-Umstand, den zu erdulden wir gerade diese Woche verurteilt waren: Frau Johanna Buska. Man könnte hier ein ganzes Kapitel Prager Dramaturgie einschalten und nachweisen, daß diese Frau, die gewiß auch ihre besonderen Eigenheiten, ja wir wollen sogar zugestehen: Vorzüge hat, daß diese Frau jenem Rollenfach, auf das sie sich justament kapriziert, absolut nicht entspricht. Man könnte das mit ästhetischen und physiologischen (jawohl, physiologischen!) Argumenten überzeugend nachweisen. Aber darauf kommt es heute gar nicht mehr an. Auch wenn die Dame um zehn Jahre jünger und hundert Prozent interessanter wäre, als sie es ist, würde unter den gegebenen Verhältnissen jeder vernünftige Direktor eine Änderung treffen. Direktor Neumann tut es nicht. Justament nicht. Und gerade deshalb nicht, weil es das Publikum, weil es die Kritik fordert. Er hüllt sich in seinen Hermelinmantel, setzt die Krone auf und sagt gebieterisch: Jetzt erst recht nicht! Denn: das Publikum ist ein Hund, der zu kuschen hat, das Publikum ist „Pöbel“, der froh sein darf, bei Gala-Vorstellungen des Hauses Neumann den Maulaffen abzugeben.
Manche Leute meinen, diese Analyse des Falles Buska sei unrichtig, und versuchen sich die Beharrlichkeit, mit welcher der Direktor seine Gemahlin dem Publikum als Salondame aufdrängt, aus merkantilen Erwägungen heraus zu erklären. Sie sagen sich, der Direktor ist in diesem Punkt eben noch schlauer, als ihr denkt. So wie manche Dorfdirektoren absichtlich Durchfallskandidaten vor die Rampe stellen, um dadurch das Publikum zu amüsieren, so läßt Direktor Neumann seine Gemahlin jugendliche Liebesszenen spielen, weil er weiß, daß auch dies Interesse findet. Die Zeitungen tadeln, die ernsten Theaterbesucher erzürnen sich, die Jugend tobt – aber die Neugierigen laufen herein, die Neugierigen, Klatschsüchtigen und Boshaften; Männer, welche nachher in der Gesellschaft, im Klub, im Café die beißendsten Witze verschleißen und alle Sottisen mit Behagen nacherzählen; Mädchen, die sich interessieren zu sehen, wie lange der Schein der Jugendlichkeit sich erhalten läßt; hysterische Jungfrauen, die angesichts solcher Künste von seltsamen Schauern der Wollust geschüttelt werden; alternde kokette Frauen, denen der Kampf der Kosmetik gegen die Gesetze der Natur eine Quelle unerschöpflicher Anregungen bietet; Dienstboten-Seelen und Lakaien-Naturen, die an dem abenteuerlichen Parfüm sich berauschen, das diese Frau ausströmt; endlich aber alle jene unappetitlichen Figuren, die der Hunger nach Freikarten dazu drängt, die Schleppe der Frau Buska zu küssen. Das ist in Wahrheit die Koterie, welche an Buska-Abenden das Theater füllt, und wenn noch der freche Lärm der vervierfachten Claque erklingt, wenn ergebene Diener des Hauses Blumen streuen, dann wird in der Frau die Meinung befestigt, sie habe abermals einen großen Triumph errungen. Die Zeitungen, die solches Treiben tadeln, werden von ihr ängstlich ferngehalten, um sich herum hört sie aus dem Munde ihrer Schmeichler abermals nur Worte des Entzückens – wahrlich, sie trifft die wenigste Schuld!
Die Frau ist fast zu bedauern. Aber umso sträflicher, umso gewissenloser ist das Verhalten der Direktion. Daß Direktor Angelo Neumann nicht als Gatte soviel Taktgefühl hat, seine Frau, die wirklich einmal eine Künstlerin war, aus dieser peinlichen Lage zu befreien, geht uns hier nichts an. Das mag er gegenüber seinem Geschmack und seinem Gewissen verantworten, aber an den Direktor müssen wir uns halten. Wir glauben es nicht, daß merkantile Erwägungen ihn zu solchem Tun bestimmen könnten. Dazu denken wir zu hoch von ihm. Es ist die Verachtung des Publikums und dessen Wünschen, es ist das Königs-Bewußtsein, welches ihm auch in diesem Falle sagt: Justament nicht!
Direktor Angelo Neumann ist ein Hemmnis für die Wiedergesundung unseres Theaters geworden.
[Montagsblatt aus Böhmen, Jg. 31, Nr. 47, 22.11.1909, S. 2‑4 (Katsch.)]
Herrn Neumanns Umgang mit Menschen
Das Kapitel „Angelo Neumanns Umgang mit Menschen“ ist wahrlich nicht neu. Es wird sich ja demnächst ein Anlaß ergeben, die Geschichte der Neumannschen Direktionsführung Revue passieren zu lassen, und bei dieser Gelegenheit darf dieses Kapitel nicht vergessen werden. Eine ganze Reihe von Künstlern wird aufmarschieren, die mit Flüchen von hier gegangen, von Theaterleuten, die hier ausgebeutet und schikaniert, von andern, die mit der Peitsche des Sklavenhändlers traktiert worden, von Schauspielern, die die Bosheiten, die Rachsucht und Niedertracht dieses Neumannschen Regimes bis auf die Neige durchzukosten hatten. Nämlich auch das gehört zu der kürzlich hier geschilderten Pose dieses Theatermachers, der gerne den König spielen möchte: die Unerbittlichkeit.
Als wir heuer im Sommer, gelegentlich eines Gastspiels des Herrn Treumann, die Praktiken der Neumannschen Direktion rügten und das Wort vom Umgang Neumanns mit Menschen prägten, da gefiel sich der Mann plötzlich in der Rolle der gekränkten Unschuld; er lief zu Pontius und Pilatus und greinte überall über das ihm angetane Weh. Herr Neumann ward damals sentimental. Leider nur liegt ihm dieses Rollenfach sehr schlecht. Nun sind wir durchaus nicht so naiv zu glauben, daß man beim Theater mit der Sentimentalität sonderlich viel aufstecken könnte. Nein, zu einem Direktor, der auf Zucht und Ordnung hält, gehört eine gewisse Härte; nur ist die von der Neumannschen „Eigenart“ himmelweit verschieden. Jeder wirkliche Leiter einer großen Bühne ist im Sachlichen unerbittlich, insofern er alles das, was er für das künstlerische Gedeihen seiner Bühne für richtig und notwendig hält, unbekümmert um persönliche Sympathien und Antipathien und ohne Rücksicht auf persönliche Vorteile und Nachteile, unerbittlich durchsetzt. Gerade das Gegenteil ist bei Herrn Angelo Neumann der Fall. Seine Direktionsführung war im Sachlichen immer schlampig, ungenau, beiläufig, und das nur, weil er sich eben niemals von sachlichen Motiven, sondern immer nur von ganz persönlichen Argumenten, von ganz persönlichen Sympathien und Antipathien, von ganz persönlichen Rücksichten auf persönlichsten Vorteil und Nachteil leiten ließ. So im Großen und im Kleinen. An welche Stelle immer man denkt, ob es sich um Dramaturgen, Regisseure, Kapellmeister und Schauspieler oder Sänger handelt – maßgebend bei Neumann war und ist immer erst das persönliche Verhältnis zu dem Mann, irgendein ganz nebensächliches, von der künstlerischen Qualifikation unabhängiges Moment. Befähigung und Talent kommen erst in zweiter Linie. Nur so ist es erklärlich, daß die wichtigsten und verantwortungsvollsten Posten mit den Unfähigsten der Unfähigen besetzt werden; nur so ist’s möglich, daß Leute das Schauspiel kommandieren und Regie führen, die woanders selbst zum Souffleur zu schlecht wären; nur so kann es geschehen, daß irgendein Mensch, der bisher nicht einmal als nebensächlicher Chargenspieler bestehen konnte, plötzlich zum Nebendirektor avanciert. Nicht das Sachliche, nicht Talent und Befähigung entscheiden, sondern der Grad einer Virtuosität, die bisher nur im Varieté geschätzt ward: der Virtuosität des Affenmenschen. Wer am besten auf allen vieren kriechen kann, der erreicht’s am Ende!
Herr Neumann, der sich von seinen Trabanten als „großer“ Direktor preisen läßt, hat weder jemals genug Kultur noch genug Bildung besessen, um eine große Bühne auf der Höhe der Zeit erhalten zu können, zum „großen“ Direktor aber fehlt ihm vor allem jenes Maß von sachlichem Ernst, ohne das ein wirklicher Bühnenleiter nicht zu denken ist. Das aber, was er gern als „Energie“, „Entschlossenheit“ und „Unerbittlichkeit“ ausgeben möchte, ist nichts weiter als ganz persönlicher Eigenwille, ein kleinlicher, eitler, boshafter Eigenwille, in dem er allerdings unerbittlich ist. Er ist darin unerbittlich, uns seine zweiundsechzigjährige Gattin als Pikanterie aufmutzen zu wollen; er ist unerbittlich, uns einen Mann als Regisseur einzureden, der seine dramaturgischen Kenntnisse sich immer erst beim Theaterportier ausborgen muß; er ist unerbittlich im Anpreisen seiner schmierigen Wagnerkulissen, die schon bei der Bayreuther Première Gelächter erregt haben, und unerbittlich ist er, wenn sich’s um eine Neumannsche Bosheit handelt.
Wie „sachlich“ dieser vielgepriesene Mann sein kann, soll uns ein kleines Beispiel zeigen. Alle Welt hat erwartet, daß Herr Neumann die neue Oper Blechs, „Versiegelt“, aufführen werde. Das Werk hat überall, wo es gegeben wurde, gefallen; Blech war lange Jahre hier, hat hier mit der Aufopferung seiner ganzen Kraft gearbeitet und genießt noch heute die größten Sympathien. Nichts naheliegender, als daß das Blechsche Werk hier mit Freude aufgenommen würde. Zudem tut uns wirklich eine Opern-Novität, die sich etliche Zeit auf dem Spielplan halten ließe, not. Herr Neumann gibt das Blechsche Werk nicht und wollte uns lieber mit Herrn Delmars „Carmela“ beglücken die aber jetzt auch nicht herauskommt, weil selbst Herrn Delmar die Pimperl-Regie Herrn Neumanns zu schlecht war. Und er gibt Blechs Oper nicht, weil er den Berliner Hofkapellmeister „strafen“ will. Blech vergaß nämlich gelegentlich seines Marienbader Aufenthalts, seine „Aufwartung“ bei Neumanns zu machen! Man wird das wieder nicht glauben, wird das wieder für eine Ranküne des „Montagsblatts“ halten, und doch ist dies verbürgte Wahrheit, die Blech selber bestätigen kann. Solcherart ist Herr Neumann, der Mann, der zu Pontius und Pilatus läuft und greint, wenn man einmal, herausgefordert durch seine Mißwirtschaft, ihn etwas unsanft beim Ohre faßt.
Seine ganze Bosheit und Brutalität aber – man kann das nicht mehr anders nennen – enthüllt der Fall der jungen Sängerin Fräulein Irma Joksch. Diese junge Sängerin hat hier im vorigen Jahre mit großem Erfolg die Nedda gesungen und wurde für das Deutsche Landestheater engagiert. Sie ist hübsch, verfügt über eine geschulte Stimme und besitzt ein Talent, das jetzt in Konzerten neuerlich die besten Proben abgelegt hat. Daß Frl. Joksch auch Herrn Neumann gefiel, läßt sich nicht bestreiten, sonst hätte er sie nicht mit einer für seine Bühne immerhin ganz respektablen Anfängergage engagiert. Trotzdem ist diese Sängerin seit ihrem Engagement nicht ein einziges Mal aufgetreten. Alle Welt fragt und wundert sich, der Intendant weiß davon und kann das Rätsel nicht lösen, die Kritik spricht darüber und verlangt Antwort – Herr Neumann aber ist unerbittlich … Doch wir wollen das nächste Mal erzählen, was zu diesem Fall zu sagen ist, und versuchen, Herrn Neumann zum Sprechen zu bringen.
[Montagsblatt aus Böhmen, Jg. 31, Nr. 49, 5.12.1909, S. 2-3 (Katsch.)]
Im Sumpfe
Österreich ist das Land der ungelösten politischen Probleme. Die Geschichte unseres Staates ist großenteils nichts anderes als die Geschichte der mißglückten Versuche, diese Probleme provisorisch zu lösen. Und die neue Zeit, die Entwicklung der Umwelt, sie fügen zu den alten ungelösten noch immer neue Probleme hinzu. Wir sagen nichts sonderlich Neues, wenn wir daran erinnern, daß die Lösung einiger dieser politischen Rätselfragen zu einer sehr dringenden Angelegenheit geworden ist, daß die bisher beliebte Verschleppung und Vertagung, die bei uns typische Scheu vor jedem entschiedenen Schritte, das ewige Flicken und mühselige Klittern beginnt, Folgen zu zeitigen, die selbst die bei uns sehr weit gesteckten Grenzen des politischen Möglichen zu überschreiten drohen. Und nichts ist, angesichts unserer dermaligen Verhältnisse, bezeichnender für den politischen Sumpf, in dem wir stecken, als die Tatsache, daß scheinbar auch die wichtigsten, brennendsten Fragen, ideelle wie materielle, die Öffentlichkeit in ihrer Ruhe nicht zu stören vermögen. Wir stehen vor einer völligen Neuorientierung der auswärtigen Politik; die alten, schlechten Handelsverträge laufen in relativ kurzer Zeit ab; die wirtschaftliche Stagnation nimmt stellenweise katastrophale Formen an; eine in diesem Ausmaße noch nicht dagewesene Erhöhung fast aller Steuern und die Einführung einiger neuer dazu steht in nächster Nähe; das reichste Kronland des Staates ist unter staatlichen Sequester gestellt – die Liste ist ja noch lange nicht erschöpft – würde in jedem anderen Lande nicht der zehnte Teil genügen, um die gesamte Öffentlichkeit bis in die letzten Tiefen politisch zu erregen? Man vergegenwärtige sich einen Augenblick, wie Fragen, die für ihr Land noch lange nicht die hohe Bedeutung haben wie etwa eine der obgenannten für uns, wie die Deckungsfrage in Deutschland, die dreijährige Dienstzeit in Frankreich, die Wahlrechtsreform in Belgien, die irische Homerule in Großbritannien, stadtauf und stadtab Wähler und Gewählte zu immer neuen Auseinandersetzungen veranlaßten, wie da von allen denkbaren Gesichtspunkten das Für und Wider erörtert, die Öffentlichkeit aufgeklärt und interessiert wurde, wie die Meinungen und Weltanschauungen im friedlichen Kampfe miteinander rangen! Und bei uns! Die Regierung tut, was sie immer getan, das heißt, sie vertraut auf Gott und wartet ab, die Herren Abgeordneten haben die Sommerfrischen bezogen, die sie zum größten Teile so wenig verdient haben, und wenn nicht die Presse täglich davon Kunde gäbe, daß bei uns doch nicht alles zum besten bestellt ist – der Fremde könnte den Eindruck eines Volkes erhalten, das politisch sehr wenig zu wünschen hat.
Wir wissen genau, welch furchtbare Täuschung dies wäre. Wir wissen, daß eine beispiellos seichte, ideenarme Politik, zu deren sachlicher Armut sich üble Formen gesellen, eine politische Verdrossenheit erzeugt hat, die scheinbar unüberwindlich ist. Und doch muß sie überwunden werden. Wenn wir den Willen zum Leben haben, müssen wir aus dem Sumpfe heraus, mag dies Geschäft im Anfange noch so peinlich sein. Der Staat muß aus einer chronischen Schuldenwirtschaft heraus, die Handelspolitik muß eine vernünftigere werden, auch in das Chaos des nationalen Strittes muß endlich Ordnung gelangen. Alles das zu intendieren, hiefür dann nach allen Seiten den Boden zu ebnen und im Einvernehmen mit der Bevölkerung kraftvoll zu verwirklichen, sollten natürlich Aufgaben der politischen Parteien sein. Diese aber haben bei uns, das bedarf wohl nicht erst eines eingehenden Beweises, fast stets versagt. Und da nicht, wie anderswo, die politischen Organisationen für eine verständige Wirtschaft zu sorgen verstehen, müssen hier die wirtschaftlichen Organisationen für eine verständige Politik sorgen. Und da nicht, wie anderswo, die Politiker und Parlamentarier das Volk zusammenberufen, um ihm neue Wege zu weisen, um es zu belehren und zu beraten, so muß sich das Volk eben die Politiker und Parlamentarier berufen und ihnen unzweideutig sagen, daß man von ihnen Ideen und Arbeit verlangt und daß man freudig auf ihre Dienste verzichtet, wenn sie statt des Brotes positiver Leistungen nur die Steine hohler Phrasen darzubieten imstande sind.
Denn auch das Parlament muß gesunden, weil ein großer Staat im zwanzigsten Jahrhundert einfach nicht mehr absolutistisch regiert werden kann; schon aus Gründen des internationalen Kredites nicht, ganz zu schweigen von kulturellen und freiheitlichen Gründen. Aber Ernst müssen unsere wirtschaftlichen Korporationen einmal machen. Sie sind heute die berufensten, um den Volkswillen, vor allem aber um die wirtschaftlichen Forderungen überallhin zur Geltung zu bringen. Und sie dürfen nicht die Schuld auf sich laden, in einer Zeit untätig geblieben zu sein, da die Politiker versagt haben. Von diesen können wir, wie die Dinge heute liegen, kaum mehr viel erwarten. Die Gesundung kann nur von unten erfolgen. Von oben können wir nie und nimmer aus dem Sumpfe geführt werden.
[Prager Tagblatt, Jg. 38, Nr. 210, 2.8.1913, Morgen-Ausgabe, S. 1 (ohne Signatur).]
Der weiße Fleck
Wir sind es unsern Lesern schuldig, einmal Antwort auf viele Anfragen zu geben, die sich zu Hunderten regelmäßig einstellen, sobald in der grauen Fläche bedruckten Papiers ein größeres weißes Loch erscheint. Gewöhnlich sind solche Anfragen von falschen Annahmen diktiert und vermuten hinter dem weißen Fleck eine nicht gerade erfreuliche Nachricht, ein ungünstiges Urteil oder einen Anlaß zu Kritik. Gewöhnlich mit Unrecht; eine ihres schweren, verantwortungsvollen Amts sich bewußte Zeitung wird heute alles vermeiden, was die gerechtfertigte Zuversicht der Menge, ihr Vertrauen und ihr frohes Hoffen irgendwie beeinträchtigen und stören könnte. Der moralische Faktor im Kriege ist zumindest ebenso wichtig wie das Glück der Waffen, und wer den Brunnen, aus dem das Volk Kraft und Mut schöpft, mutwillig trüben wollte, würde sich eines schweren Vergehens schuldig machen. Nichts also kann einem Blatt, das seine vaterländische Pflicht ernst nimmt, ferner liegen, als etwa die Rolle des Schwarzsehers, Nörglers und Besserwissers zu spielen; die Zeit ist wahrhaftig viel zu ernst, der Druck der zu bewältigenden Aufgabe zu groß, als daß eine gewissenhafte Zeitung das Wohl des Ganzen aus den Augen verlieren und sich der Pflege kleinlicher Oppositionslust hingeben könnte. Dennoch bleibt auch einem gewissenhaften Blatt nicht erspart, daß es öfter unter die Räder der Zensur gerät und dem Leser am nächsten Morgen weiße Flecke bietet, und es bleibt ihm auch dann nicht erspart, wenn es die Gebote der militärischen Zensur peinlich respektiert und sich auch von jenen Fragen der innern Politik fernhält, die vorläufig aufs Eis gelegt wurden. Wer an der Ansicht festhält, daß Schweigen besser ist als Lügen und das kürzlich in der römischen Kammer gefallene Wort von der patriotischen Pflicht des Lügens den Italienern überläßt, wird dem weißen Fleck, als dem schriftlichen Ausdruck des Schweigens, nicht allzu gram sein dürfen; er selbst wäre kaum einer Betrachtung wert, sofern er nur verschiedenen Urteilen über das Maß der diktierten Preßunfreiheit entspränge, beachtenswert wird er erst, wenn der tiefgehende Gegensatz der Meinungen über die geistige Freiheit an die Wurzeln der Vorstellung von vaterländischer Pflicht und Moral rührt.
Darin nun gibt uns unser weiteres Vaterland selbst ein Beispiel, indem jeder Tag lehrt, daß jenseits der Leitha andre Begriffe herrschen als diesseits. Wir haben es trotzdem bisher vermieden, auf unser Nachbarreich, auf Ungarn, hinzuweisen, das sich im großen und ganzen des vollen Genusses seiner staatsbürgerlichen Rechte erfreut, im Parlament und in der Presse zwei Grundpfeiler seiner inneren Freiheit besitzt: möglich, daß dieser oder jener Grund dafür vorliegt, das beneidenswert große Maß von Freiheit nicht herüber zu verpflanzen, wahrscheinlich, daß Ungarns Rechte, dank seiner geschichtlichen Entwicklung, anders fundiert sind als die unsern. Aber so stark der Unterschied zwischen den historischen Bedingungen der geistigen Freiheit hier und dort auch empfunden werden mag, so nachdenklich muß doch dies zweierlei Maß stimmen; uns bleibt versagt, was jenen vergönnt ist, sie genießen die Früchte eines politischen Talents, das diesseits der Grenzen niemals heimisch war. Aber trotz dieser Bescheidung, trotz aller Beachtung einmal gegebener Tatsachen, müssen auch hier im Abmessen der Rechte gewisse Grenzen eingehalten werden, die den Fortbestand wenn auch nicht der politischen Betätigung, so doch wenigstens des politischen Denkens gewährleisten. Es wäre phantastische Vermessenheit, zu fordern, was Ungarns Bürger als Selbstverständlichkeit hinnehmen, es ist ein Abfinden mit dem Notwendigen, wenn das Gebiet der innern Politik vorläufig als ein gefährliches Terrain sozusagen mit Drahtverhauen umgeben und jeder Erörterung entrückt wird.
Eine Frage wäre aber doch vielleicht der Erwägung wert, ob es klug ist, sich ganz nur auf jenes mechanische Prinzip des Erlaubens und Verbietens zu verlassen, das äußerlich zwar Ruhe schafft, aber dafür den ungeheuren Nachteil hat, vollkommen negativ und unproduktiv zu bleiben. Der Krieg gleicht darin in gutem Sinne einer großen Revolution, daß er mit den Mitteln der Macht Veränderungen der Geister vollzieht; die Konzentration auf die Mittel der Macht ist zum Siege notwendig, aber ebenso das geistige Miterleben. Wird die geistige Teilnahme erschwert, unterdrückt, unmöglich gemacht, dann werden wir um den besten Inhalt dieser Zeit betrogen. Kann es die Absicht der Regierung sein, den geistigen Inhalt dieser Zeit dem allgemeinen Nachdenken zu entziehen und auf ein kleines, streng abgestecktes Maß zu beschränken? Dies Verfahren gliche etwa dem Versuch, den Sturm auf dem Meere in ein Wasserglas auffangen zu wollen.
[Prager Tagblatt, Jg. 41, Nr. 188, 9.7.1916, Morgen-Ausgabe, S. 1 (Pfeil).]
Die bedrohte Presse
In der letzten Sitzung des Deutschen Nationalverbands beschäftigte sich ein Antrag des Abgeordneten Einspinner auch mit der Presse; der Antrag war sehr kurz, er verlangte, bei aller Anerkennung der militärischen Zensur, die Beseitigung der gegenwärtigen Praxis, welche der Presse jede Meinungsfreiheit nimmt und die Besprechung innerer Angelegenheiten ganz unmöglich macht, ferner aber fordert er auch die Regierung auf, „mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln der Aufsaugung der Presse durch die Geldmacht der Banken entgegenzutreten“. Der erste Teil dieses Antrags berührt den momentan wundesten Punkt unsres öffentlichen Lebens; die Freiheit der Presse, als eines der besten Stücke der bürgerlichen Freiheit, ist tatsächlich so gut wie aufgehoben. Die Öffentlichkeit ahnt gar nicht, wie weit diese Einschnürung reicht, sie weiß nicht, daß die Zensur nicht nur die wichtigsten Gebiete der allgemeinen Angelegenheiten der freien Erörterung vorenthält, sondern das Denken selbst zensuriert, sie weiß daher nicht, daß philosophische Abhandlungen etwa, wissenschaftliche Themen, Aufsätze rein historischen Inhalts, ja Gedichte, Theaterreferate genauso auf ihre „Gefährlichkeit“ hin durchsucht und zensuriert werden wie Berichte, Mitteilungen und Meinungen über Fragen und Ereignisse des Tages. Es ist jetzt aus begreiflichen Gründen nicht möglich, zu dieser Sache zu sagen, was zu sagen wäre; es muß jetzt genügen, alle Verantwortlichen für dieses Tun genau festzustellen und die Sache selbst vorläufig aufs Eis zu legen. Nachher wird man dann zeigen können, daß in diesem Kampfe, der schließlich, wie so oft gesagt wurde, angeblich auch ein Kampf der Geister sein soll, Namen wie Kant, Hegel, Fichte, Mommsen, Gervinus, Goethe, Schiller, Richard Wagner, Johannes Scherr, Springer, Rogge, Heine und Mundt,
[1 Zeile zensuriert.] zu den „Gefahren“ dieser Zeit gehören.
Der Nationalverband hat es wahrscheinlich mit seinem Antrag sehr gut gemeint, aber er vergißt vollständig, daß ihm grade jenes Mittel fehlt, worauf es in diesem Punkte ankommt: die Macht. Und seine Ahnungslosigkeit geht so weit, daß er durch seinen Obmann Dr. Groß grad jene Blätter anklagen ließ, die sich mit einiger Konsequenz der freilich ziemlich aussichtslosen Mühe unterzogen hatten, den Abgeordneten auf die Beine zu helfen. Die Abgeordneten haben diesen Rat verschmäht und nichts dergleichen getan, sich ihre Macht zu sichern; sie sahen nicht, daß beide Teile, Presse und Parlament, auf einander angewiesen sind – wie wollen sie nun, da sie machtlos sind, der Presse helfen? Erst müßten sie doch wohl tun, was ihre Kritiker von ihnen verlangt haben: sich selbst helfen; solange sie dies nicht vermögen oder dazu nicht die nötige Courage aufbringen, wird ihre gutgemeinte Forderung nach Pressefreiheit nicht mehr Wert haben als ein unbeschriebenes Blatt Papier, das in der abgeschiedenen Klause nach dem Gebrauch in den Kanal wandert. Und nicht viel besser steht es mit dem zweiten Teil ihrer Forderung. Die Wiener „Arbeiter-Zeitung“ macht sich in ihrer gestrigen Nummer über diese Forderung des Abgeordneten Einspinner lustig und fragt, was sich der Nationalverband eigentlich drunter vorstelle, wenn er die Regierung „auffordert“, „der Aufsaugung der Presse durch die Geldmacht der Banken entgegenzutreten“. Die Banken, sagt sie, könne niemand in der Betreibung ihrer Geschäfte beschränken, wenn sie daher Zeitungen kaufen und als Kapitalsanlage benützen, wird die Regierung schwerlich etwas dagegen tun können. „Es wäre“, sagt das Blatt mit bittrer Ironie, „nur die Logik der Dinge, wenn sich das Finanzkapital, das über die Welt gebietet, nun auch jenes Instruments bemächtigte, das dieser seiner Welt die kulturelle Beschaffenheit zu bescheinigen hat. Aus dem Weltkrieg, der alles zerreibt, wird doch nur eine einzige Klasse dick und fett hervorgehen: die Finanzkapitalisten, die in ihren Schränken voll bedruckten Papiers die Herrschaftstitel über alle Güter ihr eigen nennen. Indem wir alle verarmen, mehrt sich ihr furchtbarer Reichtum; was wir verlieren, sammelt sich bei ihnen bergehoch an. Ehemals meinten sie, ihren Glanz zu erhöhen, wenn sie ihrem Troß einen adeligen Namen einverleibten; nun vervollständigen sie ihre Macht, wenn sie den mannigfachen Werkzeugen ihres Willens eine Zeitung zugesellen. Es wird einstmals zur Etikette des Finanzkapitals gehören, daß jede große Bank ihre große Zeitung besitzt und daß die großmächtigen Herren, die über Eisen und Kohle, über Zucker und Baumwolle, über Schnaps und Leder gebieten, auch über die Zeitungen gebieten werden und, so wie sie sich die Welt in ihren leiblichen Bedürfnissen botmäßig gemacht, sich auch die der geistigen Bedürfnisse tributär machen werden.“
Nun, so weit wollen wir es nicht kommen lassen, und so weit wird es auch nicht kommen. Auch in dem Punkt, der diese Bedrohung der Presse betrifft, hat es der Nationalverband gut gemeint; er fühlt ganz richtig, daß die Presse einem konzentrischen Angriff von rechts und links ausgesetzt ist, daß man ihr von beiden Seiten die Möglichkeit der freien Äußerung nehmen will. Aber auch in diesem Punkt wetteifert seine Ahnungslosigkeit mit seiner Naivität. Ein gut geleitetes, von seinen Lesern getragenes Blatt wird als ein rentables Unternehmen wohl das Auge des Kapitals auf sich locken, aber diese Rentabilität, die so verlockt, ist nicht einem „Geschäft“ gleich, das von einer Hand in die andre wandern kann, sie gründet sich vielmehr auf das Vertrauen der Leser und die Achtung der Öffentlichkeit, auf zwei Faktoren also, die untrennbar verbunden sind mit der Freiheit der Meinung. Ein freies, von dem Vertrauen seiner Leser getragenes Blatt bedarf auch keines Souteneurs, keines Aushälters oder Mäzens; sein Kapital ist seine Unabhängigkeit, sind seine Leser. Wollten nun Besitzer oder Bank diese Freiheit, die beste Gewähr eines Blattes antasten, dann würden sie zugleich grade das vernichten, worauf ihr Auge so wohlgefällig fiel: die materielle Quelle der Zeitung. Der Nationalverband sieht Gefahren, die der Presse drohen, er irrt aber vollständig, wenn er dabei an die Regierung appelliert. Denn es gibt nur eine Sicherung für die Presse und nur ein Mittel für eine bessere Zukunft: die Pressefreiheit. Ist die Presse frei im Wettbewerb der Blätter und frei in ihren Äußerungen, dann kann ihr keine Macht der Welt etwas anhaben. Mögen dann Kapitalisten aufkaufen, soviel und welche Blätter sie wollen, es werden im freien Wettbewerb freie und unabhängige Blätter erstehen. Die Unabhängigkeit und Freiheit der Äußerung ist so notwendig zum Leben wie Luft und Wasser.
[18 Zeilen zensuriert.]
[Prager Tagblatt, Jg. 41, Nr. 260, 19.9.1916, Morgen-Ausgabe, S. 1 (Pfeil).]
Die Umkehr
Heute, da alles so eingetroffen ist, wie wir es vor Jahr und Tag vorausgesehen hatten, muß es uns gestattet sein, auch ein Wort in eigener Sache zu sagen. Wir sind dies der Politik, die wir vertreten, unsern Lesern und zuletzt wohl auch uns selbst schuldig.
Unsere Leser erinnern sich, daß wir noch zu Lebzeiten Stürgkhs auf die Notwendigkeit des Parlaments hingewiesen und immer wieder gemahnt haben, die Frage der Erneuerung unsres politischen Lebens und unsrer öffentlichen Einrichtungen in Angriff zu nehmen. Es war damals einer halbwegs pflichtbewußten Journalistik wahrlich nicht leicht, das zu sagen, was sie zu sagen als notwendig hielt; Graf Stürgkh hatte die Zügel der Zensur fest in der Hand und unterdrückte jedes Wort, das innern Angelegenheiten Österreichs galt. Sein von allen guten Geistern verlassenes System hat vieles verschuldet, aber es wäre ein Vergehen an der historischen Wahrheit, wenn man nicht heute feststellen würde, daß dieses System mit allen seinen Folgen sich nur halten konnte, weil es von der offiziellen deutschen Politik und leider auch vom größten Teil der deutschen Presse Österreichs gestützt wurde. Warum die ehedem populärste Partei des deutschen kleinen Mannes und Mittelstandes, die Deutschradikalen, dieses für alle folgende Zeit verderbliche System guthieß, ist sehr bald aufgeklärt worden; daß die Presse Deutschösterreichs mitschuldig wurde, hatte seine besonderen Gründe: die deutschradikalen Provinzblätter folgten einfach dem Kommando ihrer Parteihäupter, und die großen, unabhängigen Journale, auf deren Stimme es vor allem angekommen wäre, parierten aus Opportunismus oder aus Mangel einer eigentlichen Meinung.
So war es nur ein kleines Häuflein, das in der entscheidenden Zeit, da der Deutsche Nationalverband seinen Marsch in die Sackgasse antrat, vor dieser Politik warnte und selbst auf die Gefahr hin, angepöbelt und denunziert zu werden, den fundamentalen Fehler der führenden deutschen Abgeordneten bekämpfte. Was war der Gegensatz der Anschauungen, worin bestand unsere Opposition gegen die offizielle Politik des Deutschen Nationalverbands? Wenn man die Verfechter dieser Politik und die deutschradikalen Schriftleiter hörte, dann tönte uns stets nur das armseligste Geschimpfe entgegen, das seit Jahren zu dem polemischen Handwerkszeug dieser Journalistik gehört. Die ganz hinterwäldlerisch veranlagten Gehirne, die mit den Schlagworten provinzieller Bierstuben unsre Meinung niederzuknüppeln wähnten, kann man ruhig beiseite lassen. Sie werden heute wohl einsehen, daß man mit den paar Kraftworten des deutschradikalen Kommersbuches keinen politischen Erfolg erzielt. Aber dann gab es etwas klügere, national sehr zuverlässige und im übrigen durchaus achtenswerte Leute, die gegen unsre Warnungen und unsre Kritik remonstrierten und unsrer Haltung die lächerlichsten Motive unterschoben. Sie alle sahen nur das Äußerliche, nicht das Wesentliche, sie begriffen nicht, worin der Kern des Gegensatzes lag, obwohl wir ihn in hundert und mehr Artikeln immer wieder herauszuschälen uns bemühten. Wir sagten und belegten es mit einem Dutzend Beispielen aus der Geschichte der Deutschen in Österreich, daß es ein Unding sei, die wirkliche Macht, die ein Volk nur im Parlament ausüben kann, aus der Hand zu lassen und sich auf eine Politik des Vorzimmers, der Versprechungen und Geschenke festzulegen. Daß uns die führenden Männer des Nationalverbands nicht verstanden, war wohl begreiflich; sie, die stets nur Couloirgedanken, niemals politisches Denken kennengelernt hatten, meinten, es handle sich hier um einen „taktischen“ Streit, sie sahen nicht den Gegensatz zwischen politischem Denken und Taktik, erkannten nicht, daß diese Zeit von der politischen Führung der Deutschen Österreichs mehr forderte als „Taktik“. Darum begriffen sie auch das Koerbersche Programm nicht; hier standen eben politische Gedanken contra Taktik. Darum aber verdächtigten sie jeden, der damals in den Tagen des Koerberschen Regimes sich mit allen Mitteln für die politischen Gedanken und gegen die Taktiker wendete.
Es ist nicht unsere Schuld, daß das „Prager Tagblatt“ unter der deutschbürgerlichen Presse damals fast allein stand, wie es nicht unsre Schuld war, daß die Radikalen in ihrem Unverstand einen wahren Janhagel gegen unser Blatt entfesselten. Die albernen Beschuldigungen, daß die nationalen Forderungen der Deutschen Böhmens bei uns kein Gehör fänden, konnte nur auf dumme Köpfe wirken. Wir waren mit die ersten, die für die Kreiseinteilung Böhmens, für die Festlegung der deutschen Verkehrssprache sich einsetzten, und an der Versicherung, daß der Inhalt der deutschen Forderungen gut und richtig sei, hat es nie gefehlt. Aber der Weg zu ihrer Durchsetzung war falsch, und darin hat uns die weitere Entwicklung recht gegeben. Es ist alles so eingetroffen, wie wir es vorausgesehen hatten, alles mit einer solchen Notwendigkeit, daß wir auf unser Urteil immerhin stolz sein können. Aber freilich, wer vermöchte froh zu sein angesichts eines Fehlers, der doch nur durch die Mängel unsrer offiziellen deutschen Politik, durch den Mangel eines echten politischen Sinns und politischer Bildung verschuldet wurde! Dort, wo wir heute stehen, hätten wir vor Jahr und Tag stehen können und wären daher heute viel weiter, wenn die offizielle deutsche Politik nicht von falschen Voraussetzungen und veralteten Anschauungen ausgegangen wäre. Daß uns dieser Rückzug aus der Sackgasse nicht erspart blieb, daran ist nicht nur die Führung der deutschen Politik, sondern auch der größte Teil jener Presse schuld, die, auf jedes politische Denken, auf jede selbständige Meinung verzichtend, sich zur dienenden Magd populärer Schlagworte und leerer Gehirne erniedrigt hat.
[Prager Tagblatt, Jg. 42, Nr. 106, 19.4.1917, Morgen-Ausgabe, S. 1 (Pfeil).]
Rückkehr zu Stürgkh
Seit ein paar Wochen bieten die österreichischen Blätter das Bild eines Zebras; sie sind im allgemeinen – obzwar viel zahmer als dieses an die schöne Freiheit gewöhnte Tier – genau wie dessen Fell schwarz-weiß gestreift. Und das gilt nicht nur von der oppositionellen Presse, die, an diese Erscheinung gewöhnt, den weißen Fleck als tägliche Erscheinung hinnimmt: nein, auch der Leser des zahmeren Blattes wird von der Hand des Staatsanwaltes gezwungen, die Lektüre zu unterbrechen und täglich ein paar Stellen zu überspringen, auf denen nichts als weiße Leere gähnt. Nun mag man sich von dieser fürsorglichen Tätigkeit was immer versprechen, Tatsache bleibt, daß nur das Gegenteil der beabsichtigten Wirkung erreicht wird; gerade der brave Mann, der sonst sein Auge rasch über die Seiten schweifen läßt, wird stutzig und erhebt die Frage, was denn wohl die weißen Flecken verbergen mögen. Und in der Tat, heute kann man überall diese Frage hören, daneben aber auch den Ausdruck eines beschämenden Gefühls, das diese wieder aufgelebte Praxis als eine höchst unzeitgemäße Bevormundung empfindet. Eben noch hat man sehr laut verkündet, daß Österreich den Geist der Zeit begreift, daß die Feinde kein Recht haben, unsere Einrichtungen scheel anzusehen, eben noch hat man mit dem Aufwande vieler Lungenkraft die Freiheit des Wortes gepriesen; aber in Wahrheit sieht es damit recht fraglich aus. Das Bild der Wirklichkeit straft die Sänger Lügen. Wir sind – man kann es nicht anders sagen – zu Stürgkh zurückgekehrt.
Wen will man denn eigentlich täuschen, wen irreführen? Die Versammlung in Prag, die alle Stämme der Tschechen froh vereinte, hat so und so viele Tatsachen ergeben, mit denen sich auseinanderzusetzen Pflicht jeder ernst zu nehmenden Regierung wäre, Pflicht der Presse ist. Die Regierung des Herrn Dr. von Seidler wählt einen anderen Weg, sie läßt die Dinge gehen, wie sie sind, setzt aber dann die Staatsanwälte in Bewegung, um das Bild des Tatsächlichen aus dem Spiegel der Ereignisse auszumerzen. Wird mit diesem allzu kindlichen Spiel etwas geändert, wird auch nur beiläufig erreicht, was man angestrebt? Im Gegenteil. Alle Welt weiß heute, daß die Prager Berichterstattung Mittel und Wege gefunden hat, um den weißen Flecken zu entgehen und auf Druckpapier, wenn auch nicht in der Presse, zu sagen, was sie auf dem Herzen hatte. Man sollte meinen, daß nach so vielen Mißerfolgen und Erfahrungen der Geschichte die technische Unzulänglichkeit der Stürgkhschen Methode außer Zweifel stehe; es ist einfach kindisch, sich einzubilden, daß weiße Flecke eine Tatsache totmachen. Aber weit ärger als diese Unbelehrbarkeit im Technischen ist das geistige Armutszeugnis, das sich die wiedergekehrte Stürgkhsche Methode ausstellt. Ja wenn das so einfach wäre, mit dem Stifte des Zensors die Wirklichkeit zu ändern, dann könnte bald jeder regieren und die weisesten Staatsmänner aller Zeiten überragen. Es ist auch nicht anzunehmen, daß die gegenwärtige Regierung in der Rückkehr zu Stürgkh die Lösung des österreichischen Problems gefunden zu haben meint. Hier ist nichts anderes als ein Mittel der Verlegenheit, das offene Eingeständnis der Programmlosigkeit und des Mangels jeder Idee. Wie hätte es auch anders kommen sollen? Graf Stürgkh hat nur konfisziert, aber geschwiegen; Clam-Martinic hat geredet, aber Dr. von Seidler redet und konfisziert. Aber weiter ist man während der Zeit der größten Umwälzungen Europas nicht gekommen. Keiner der drei Männer hat auch nur den Versuch gemacht, dem Problem ernstlich an den Leib zu rücken; man hat die Behandlung der Personen für das Wichtigste gehalten, hat die politische Polizei und die Militärgerichte walten lassen, hat Gefängnisse gefüllt, um nachher wieder die schweren Tore zu öffnen. An die Behandlung der Sachen mochte niemand heran. Politische Probleme lassen sich aber nicht wie Personalfragen erledigen. Sie wachsen weiter und wachsen dem, der sie zu meistern hätte, schließlich über den Kopf. Was wird Herr von Seidler tun, wenn in wenigen Tagen wieder das Parlament zusammentritt und ihm aus hundert Kehlen das alte Lied entgegenklingt? Meint er auch heute noch mit ein paar rasch herbeigeholten Redensarten fortkommen zu können? Oder wird man auch auf das Parlament die Stürgkhsche Methode anzuwenden suchen? Die Männer des Hauses innerhalb der vier Wände reden zu lassen und aus ihren Reden nachher alles ausmerzen, was unangenehm und peinlich ist? Wir meinen, die Zeit sei doch ein bißchen zu ernst, um dieses Spiel fortsetzen zu können. Selbst wenn Herr Dr. von Seidler alle Staatsanwälte seines Reiches in Bewegung setzt, wird er nicht hindern können, daß uns Europa in die Fenster schaut, und es ist keineswegs gleichgültig, wenn dabei konstatiert würde, daß sich seit hundert Jahren in diesem Staate nichts geändert hat. Die Rückkehr zu Stürgkh läßt ein solches Urteil fast befürchten.
[Prager Tagblatt, Jg. 43, Nr. 12, 13.1.1918, Morgen-Ausgabe, S. 1 (Pfeil).]
Tisza, die Frauen und der Krieg
In diesen Tagen klang’s wie Pferdegewieher zu uns herüber; Graf Tisza und die Seinen hatten wieder einen Sieg errungen. Nachdem sie das allgemeine Wahlrecht in Ungarn entstellen und den ursprünglichen Entwurf zu einem armseligen Wechselbalg verunstalten durften, haben sie jetzt auch die Vorlage, die einem Teil der ungarischen Frauen das politische Recht geben sollte, in Grund und Boden getrampelt. Der Plan war nichts weniger als radikal, er hielt sich in sehr beschränkten Grenzen und reichte bei weitem nicht an die englische Reform heran; aber auch dieses bescheidene Stückchen politischer Reform hat vollauf genügt, um den Zorn der Tisza-Mehrheit zu entfachen; der frische Gedanke, der sich wie eine Taube in den Zwinger bösartiger Tiere, unter das Dach des Budapester Parlaments verirrt hatte, ist in tausend Stücke zerrissen worden. Es lohnt nicht, auf die Reden und Argumente auch nur beiläufig einzugehen, die man von den Gegnern der Vorlage zu hören bekam; sie bewegten sich fast ausschließlich auf dem Niveau jener hausväterlichen Weisheit, die dem Weib die Rolle der Magd, Köchin, Heimsklavin und stumm ergebenen Kindergebärerin anweist, ohne auch nur zu ahnen, daß der Krieg der Frage des Weibes ein neues Gesicht gegeben hat. Ach, welch billigen Ausverkauf ältester Ladenhüter gab es da, als die Anwälte der besten aller Ordnungen zum Thema vom Weibe sprachen! Die Philosophie des Schweinestalles wetteiferte mit der Moral des Mädchenhandels, um die politische Attacke der Frauen abzuwehren.
Die Abwehr ist geglückt; kein Weib wird die Kreise Tiszas stören. Aber glaubt jemand, daß damit auch die Frage der Frauen erledigt ist, glaubt jemand, daß kurzsichtige, bornierte Parlamente sie aus der Welt schaffen, den Notschrei des Weibes ersticken können? Hören sie es nicht, daß die Frage des Weibes von heute mehr ist als die Frauenfrage von gestern? „Frauenfrage“ sagte man einst und meinte vereinzelte Bestrebungen intellektueller Damen, die Anteilnahme gebildeter Frauen an sozialen Erscheinungen, die Not unverheirateter Mädchen, die Sorgen arbeitender, in Berufen tätiger Frauen. All das existiert auch heute und hat nichts von seiner Aktualität verloren; da der Krieg die Männer mordet, wird die Not unversorgter Mädchen noch größer werden, der Zwang, sich nach Beruf und Arbeit umzusehen, noch viel öfter als bisher der Fall gewesen, an Frauen herantreten. Welche Verschiebungen sich darin vollzogen haben, wird erst der Friede voll aufzeigen: heute können wir nur an der Hand der drohenden Ziffern Vermutungen anstellen, beiläufige Entwicklungsrichtungen abstecken. Die Ziffern Deutschlands, die das künftige Verhältnis der Geschlechter voraussagen, sprechen deutlich genug: auf tausend Männer werden elfhundert Frauen kommen – eine Gleichung, deren umwälzende Bedeutung nicht zu verkennen ist.
So vielsagend und in ihren Folgen unabsehbar diese Sorgen der Frauen indes auch sein mögen, so treten sie augenblicklich doch zurück vor einer noch wichtigeren, tiefern Frage. Die Welt, die den Krieg nicht zu hindern vermochte, die bewußt oder unbewußt auf die Katastrophe zusteuerte, ist an Menschlichkeit so arm geworden, daß sie für den ursprünglichen Begriff „Weib“ kaum noch das richtige Gefühl hat; einzig beim Worte „Mutter“ wird die Erinnerung daran wach, daß es etwas gibt, was mehr in sich birgt als der Begriff „Frau“, und es ist kein Zufall, daß eines Dichters Gemüt den Krieg als „die große Not der Mütter“ empfand. Wird dieses Verstehen des Mutterleids sich nicht zu weiterer Erkenntnis weiten? Wird die verwüstete Welt sich nicht dessen bewußt werden, daß sie des Weibes bedarf, das allein noch die Sprache der Menschlichkeit zu sprechen scheint, wie es allein die reinen Instinkte der Natur in sich trägt? Über allen Deutungen nämlich, die der Krieg erfahren hat, über allen sachlich-männlichen Definitionen, die Gelehrte und Fachmänner, Professoren der Geschichte und Politiker, Enthusiasten der Zerstörung und Propheten des Machtwillens gegeben haben, über allen Auslegungen des männlichen Gehirns steht mit blutiger Schrift geschrieben: der Bankerott des männlichen Intellekts. Der Mann ist der Sache zum Opfer gefallen, er ist Maschinenbauer, Kaufmann, Soldat, Nationalist, Pfaffe, Literat, Entdecker und weiß Gott was alles gewesen, nur Mensch war er nicht. Er hat sich der „Sache“ so hingegeben, daß er darüber sein Menschentum vergaß. Nur das versachlichte Gehirn des Mannes, die völlige Verdrängung des Ursprünglich-Menschlichen im Manne konnte den Krieg gebären.
Jetzt, nach vier schweren Kriegsjahren, regt sich die Stimme des Gewissens, jetzt setzt auch, angesichts der erkennbaren Folgen der Katastrophe, die prüfende Kritik allmählich ein. Aber das sachlich-beschränkte Männergehirn kommt aus seinem Kreis nicht heraus, es sucht die Quelle des Irrtums im Sachlichen, im politischen Detail, im Technischen, es fordert Sicherungen für die Zukunft durch Korrekturen der Grenzen, durch Pläne zu Verträgen und Kongressen; nur an einer Forderung geht es vorbei, an der großen, einfachen Forderung: Werdet Menschen!
Um diesen Ruf hörbar zu machen, um ihn den Schwerhörigen in die Ohren zu schreien, dazu bedarf es des Weibes. Und es ist Zeit, sich dessen zu erinnern, denn der Mann war auf dem besten Wege, das Weib zu korrumpieren. Das Wertvollere an ihm, den Instinkt und die Menschlichkeit, hat er in Mißkredit gebracht, zwei Elemente, deren die Welt bedarf. Nur das Weib kann die Welt retten. Die unmittelbare Konsequenz dieser Erkenntnis aber ist die Politisierung der Frau. Die Frau muß in die Politik; nicht um dem Manne ähnlich zu werden, sondern um die politische Welt des Mannes mit der einfachen Stimme der Menschlichkeit zu zerstören. Die Politik muß auf die primitivsten, auf die menschlichsten Probleme reduziert werden; und dazu bedarf es der Frau.
[Der Friede, Bd. 2, Nr. 27, 26.7.1918, S. 9-10 (ohne Signatur).]
Die wahren Hochverräter
Es bereitet sich ein Trauerspiel vor. Das alte Österreich, aus tausend Wunden blutend, schwach am Körper, noch schwächer am Geiste, geschunden und gerädert von seinen Herren und Peinigern, entkräftet wie ein hilfloses Tier, das viele Qualen über sich ergehen lassen mußte, dieses arme alte Österreich will sterben. Es hat Jahrhunderte überdauert, hat stolze Tage gesehen voll Macht und Reichtum, war umworben gewesen wie eine schöne Frau und so stark, daß es sich die große Ausschweifung erlauben konnte, auch seine bösen Träume wahr zu machen; es schien so unerschütterlich, daß ihm die Laune gestattet war, sich seiner Tugenden zu entledigen und seine Laster als Eigenschaften des Charakters zu deuten – gab es etwas, das diesem Österreich versagt gewesen wäre, schien es nicht das Glückskind unter den Staaten, vom Schicksal ewig verhätschelt, auch in der Not und im Unglück mild und sanft behandelt, als ob eine gütige Fee um seinen Bestand besorgt wäre? Es hat Stürme entfesselt in der Geschichte und ungeheuere Feuersbrünste, es durfte, seinem tyrannischen Willen folgend, gegen die Natur wüten, es griff mit seinen Armen nach fremdem Besitz, riß ferne Länder an sich, es war Herr in Europa, schrieb Recht und Sitte vor, wußte zu schmeicheln und anzuziehen, aber auch bös, hart und grausam zu sein wie kein zweiter, wenn es anderer Denken und Fühlen unter die Gesetze des Stammlandes zwang, es hat Wunder vollbracht in der großen Welt wie der Künstler im Gewächshaus, der die Natur auf den Kopf stellt und nach seinem Einfall formt, es nahm ganzen Völkern die Seele aus dem Leib und ersetzte sie durch künstliche Gebilde, es mischte Rassen und erfand neue Gattungen, es sprengte uralte Fesseln, korrigierte die Grenzen, warf Nationen durcheinander wie Steinchen eines Kinderspiels, ihm schien alles erlaubt und nichts zu mißglücken.
Wie oft hat sich die Welt empört gegen diese kunstvolle Art, die Menschen zu behandeln, wie oft sich zu befreien gesucht von dem Zwang der österreichischen Hand! Aber aus allen Stürmen ging Österreich heil hervor. Der dreißigjährige Veitstanz der europäischen Menschheit, der Österreichs Boden entsprungen war, verwandelte Deutschland in eine Wüste, warf das große Volk von der Höhe seiner stolzen Stadtkultur in die Tiefe kümmerlichsten Elends; aber Österreich selbst blieb erhalten. Die Kriege des achtzehnten Jahrhunderts verschoben die Grenzen aller Länder und jeder Macht; Österreich überstand auch diese Probe und blieb erhalten. Der ungeheuere Aufruhr der Französischen Revolution spie wie ein Vulkan Pech und Feuer auf alles ehrwürdig Alte, Napoleon, das Kind der Revolution, zog gegen Österreich, schlug dessen Heere, zerstampfte die Fluren, zerriß die Karte, wurde Herr in Wien und Schönbrunn, und am Ende triumphierte doch wieder Österreich. In Wien wurde das alte Europa neu abgesteckt, in Wien der alte Geist befestigt, von Wien aus der Geschichte der weitere Weg vorgeschrieben. Gab es noch eine Kraft, die diesem unerschütterlichen Reich gefährlich werden konnte? War es nicht bestimmt, ewig zu stehen? Die Empörung einer beleidigten Welt hatte gegen seine Mauern getobt, die besten Schwerter suchten ihm den Kopf abzuschlagen, der größte Geist rang mit ihm – Österreich widerstand. Mußte es nicht an einen geheimen Sinn der Geschichte, an eine höhere Fügung glauben? Und wie spurlos im großen und ganzen glitt die bewegte zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts an dem alten Reich vorüber! Die Revolution der Bürger? Sie hat Unwesentliches geändert. Die Geburt der nationalen Bewegung und der nationalen Staaten, die größte der Gefahren, kürzten seinen Leib im Süden, nahmen ihm ein Recht im Norden, aber erschütterten nichts an seinem Bau. Und mit welch geringem Aufwand hat das alte Österreich all diesen Stürmen zu trotzen gewußt! Auch darin hat es alle Gesetze auf den Kopf gestellt. Mit wenigen Ausnahmen konnte es auf das Genie, auf Geist und Talent verzichten, wie als ob es hätte sagen wollen: Ich bin mit anderen Mächten verbunden, der Hilfe des Geistes kann ich entraten. Es war mehr ein Spaß und für die Buben der Schule, wenn man den Marschall Browne und den alten Laudon dem Feldherrngenie Friedrichs gleichstellte; es war eine Justamentsache, aus dem Fürsten Schwarzenberg, dem Initiator des lächerlichen Feldzuges nach Frankreich, einen Strategen zu machen. Bei Solferino und Königgrätz kommandierte das wahre Österreich, und im Grunde genügten die Thun, Festetics, Clam-Gallas und Krismanic. Konnte Österreich etwas geschehen? Es war so fest an den Himmel gebunden, daß es nicht nur seine Feldherren, sondern auch seine Minister vertrug. Nein, hier war ein Wunder, glaubet nur.
Und nun soll dieses alte Österreich sterben? Nun plötzlich soll, was sechs Jahrhunderten standgehalten, nicht mehr sein? Hat sich etwas an seinem Wesen geändert, ist der unbekannte Vertrag gelöst, der das Reich über alle Fährnisse getragen? Ach, man sagt, die Völker hätten sich von ihm abgewendet, die Nationen wollen das Band lösen, welches so lange gehalten. Aber ist das die einzige Erklärung, ist das die Kraft, die dem alten Reich den Atem raubt? Es hat viel gesündigt, viel verschuldet durch seine merkwürdige Ökonomie, den Geist nie anzustrengen und sich stets lieber auf das Glück als auf den Verstand zu verlassen. Aber soll es deshalb zu Grunde gehen, soll dieser seltsame Bund, der sich gegen alle Gesetze ein halbes Jahrtausend behauptet, chaotisch sich lösen, weil die Naturkraft der Nationen es so will? Fast scheint’s so zu sein. Und das Merkwürdigste: man läßt dieses alte Österreich in seiner Todesstunde allein. Kein Arm rührt sich, ihm zu helfen, keiner der vielen Räte gibt Rat.
Nein, diese Stunde darf nicht vorübergehen, ohne daß ihr Bild festgehalten werden würde. Es ist einfach eine historische Schmach, wie dieses alte Österreich stirbt. War es denn wirklich niemandem etwas, war es gar keine Realität, war es ein Traum von gestern, daß man es achselzuckend begräbt? Die Besten und Tapfersten dieses Reiches hatten ein Recht, ungehalten zu sein, sie hatten die verfluchte Pflicht, zu fluchen und zu wettern, sie durften seine Geschichte schwarz sehen, weil sie eine hellere Zukunft kommen sahen, weil sie an bessere Tage glaubten und für die Möglichkeit dieser Zukunft stritten. Mag diese fluchwürdige Koalition aus Unverstand, Gemeinheit und engstem Eigennutz, die sich als Partei des Patriotismus gebärdete, auch tausendmal jede Kritik am Staat beschimpft und besudelt haben, mag sie in ihrem Verbrechertum jeder edlen Opposition in den Arm gefallen sein – heute kann man es ja sagen: es hat unter den Alten, es hat unter den Jungen ein gutes Österreichertum gegeben, es hat hier Idealismus und Aufopferungsfähigkeit gelebt, die dem Staate helfen, ihn retten und bessern Zeiten zuführen wollten. Es war nicht Rechthaberei, nicht die leere Lust am Krawall und am Besserwissen, wenn diese lautersten Menschen des Staates sich die Lungen ausschrien und die Finger wundschrieben, um das Notwendige vorzubereiten und die Köpfe dafür zu gewinnen. Gewiß, sie sind verhöhnt, verulkt, angefaucht und bespuckt worden; man hat die Staatsanwälte mobilisiert, hat ihnen den Mund zu stopfen gesucht und sie doch nicht dazu gebracht, in verzweifelndem Pessimismus die Arbeit einzustellen. Sie stießen auf Böswilligkeit, auf Unverstand und auf jene tierische Borniertheit, die noch gestern gemeint hat, den Staat von Stallknechten, Henkern, Polizisten und Carriereschnaufern retten lassen zu können, und auch das hat sie nicht abgehalten, zu sagen, was ihnen notwendig schien. Aber es ist der Fluch dieses Landes, daß seine besten Freunde verfemt und verfolgt werden, während die wahren Hochverräter glänzen und in der Sonne stinken dürfen.
Es ist sündhaft und unverzeihlich, welch schweres Verbrechen an Österreich begangen wurde! Man hat eine Riesenrazzia auf allerhand kleine „Hochverräter“ veranstaltet, hat ein ganzes Heer von Staatsanwälten, ordenshungrigen Richtern und Auditoren, Polizisten und Konfidenten auf arme Teufel und Worthelden losgelassen und gemeint, dem Staate weiß Gott welchen Dienst damit zu erweisen. Aber dieweil saßen die wirklichen Herren Hochverräter in Amt und Würden und verhinderten mit vereinten Kräften, daß dem Staate geholfen werde. Wo sind denn jetzt diese Patrioten, die sonst das Maul so voll genommen, wenn es an der Krippe zu fressen gab? Wo sind die Schmeichler, Lecker, Kriecher und Augenverdreher, die sonst ihren Patriotismus plakatierten? Wo ist das große Heer der sogenannten staatstreuen Herrschaften, die sich bei jeder Gelegenheit schwarz-gelb lackierten? Sie alle wittern Morgenluft und drücken sich beiseite. Aber die eigentlichen Mörder dieses Staats sitzen in den Amtsstuben und Redaktionen. Der aus Bosheit und Schwachsinn zusammengesetzte Benedikt allein hat mehr am Gewissen als alle von ihm so viel beschimpften Masaryks und Benesche zusammengenommen. Er hat jeden ehrlichen politischen Sanierungsversuch mit Dreck beworfen, hat mit seinem Geschrei noch allemal die Trottelschaft rebellisch gemacht, wenn ein guter Plan Aussicht auf Erfüllung hatte, er war dreist genug, Männer mit seinem Tintensaft zu bespritzen, deren Fußtritt er noch als Ehrung empfinden müßte.
Diese Verbrecherkolonie, die Österreichs gequälten Leib aufs Sterbelager gebracht hat, weiß heute nichts anderes, als das Schicksal des Staates der Friedenskonferenz zu überlassen. Es ist für Leute, die nichts gelernt haben, nichts wissen und zu diesem Land in keinem anderen Verhältnis stehen als in jenem des Plünderers zu seinem Opfer, der bequemste Ausweg. Jede positive Tat, jede Arbeit ist ihnen unbequem; sie können nur sein, wenn nichts gemacht wird. Und im Grunde ist ihnen heute schon recht, was immer mit Österreich geschieht. Denn sie sind bereits fest entschlossen, immer und unter allen Umständen dasselbe zu tun, was sie bisher getan: zu plündern.
[Der Friede, Bd. 2, Nr. 39, 18.10.1918, S. 293-294 (Kajetan).]
Die „hundert Familien“
Es war ganz illustrativ, daß sich an einem Tage zwei Ereignisse vollzogen: drüben im Zentralparlament fand sich noch einmal das Herrenhaus zusammen, die wahre Repräsentation jenes Österreich, das nun zu Grabe getragen wird; im niederösterreichischen Landtagsgebäude fand sich die Versammlung der deutschen Abgeordneten ein, um einen neuen Staat ins Leben zu rufen. Das Haus der Herren war sichtlich zusammengeschmolzen, ein großer Teil hatte darauf verzichtet, noch Wirklichkeit zu posieren, da die Kulissen der einstigen Herrlichkeit vom Sturm dieser Tage bereits über den Haufen geworfen waren; immerhin, ein Rest war noch übriggeblieben, groß genug, um das Wesen dieser geborstenen Welt erkennen zu lassen. Was hier saß, hatte Ansehen und Macht im Staate, hier saßen die Besitzer der Latifundien, die Männer des großen Grundbesitzes, denen schon in der Wiege das Recht gegeben worden war, ohne Rücksicht auf Talent und Fähigkeit über ihre Mitmenschen zu herrschen und dem Staate Direktiven zu geben; hier versammelte sich der gesamte Adelsalmanach Österreichs, hier galt die Geburt mehr als das Verdienst. Die wenigen Köpfe, die unter Uniformen und Ordensbändern glänzten, waren nie mehr als eine kleine Konzession an den Geist, eine dekorative Beigabe gewesen, die nur geduldet wurde, solange sie schwieg, und das Gebrülle des Stalles gegen sich hatte, sobald sie sich wie der tapfere Lammasch erkühnte, im Hause der Lüge und Dummheit die Wahrheit zu sagen.
Es war wohl wert, am 21. Oktober das Haus der Herren zu betrachten! Wo war nun jene Sprache geblieben, die sich einst angemaßt, der Geschichte die Wege zu weisen; wo jener unbelehrbare Dünkel, der von der Höhe der Ritterburg und des Geldsacks auf die Niederungen gewöhnlicher Menschheit herabsah? Ach, wie lange ist’s doch her, daß wir von hier aus das Preislied auf die Vorherrschaft der Gewalt, das Lob auf die harte Faust, den Schrei nach dem starken Mann, die Verhöhnung freien Denkens, die Beschimpfung jeder anständigen Gesinnung vernommen! Da saßen sie nun, die Exzellenzen und Grafen, die man uns seit Jahrzehnten als die Auslese des wahren Österreichertums gezeigt, auf den Trümmern des alten Reiches und sahen verwundert die tiefe Wandlung um sich her. Ach, wären sie wirklich gewesen, wofür sie sich hielten, wären sie die Repräsentanten einer alten Welt und Weltanschauung, dann hätte dieser Untergang doch etwas von Tragik und Größe haben müssen. Und in der Tat, oft genug in der Geschichte wußten dem Untergang geweihte Geschlechter mit Anstand und Würde zu sterben, oft genug, wie im Frankreich der großen Revolution und auch jetzt im Deutschland der siegenden Demokratie, haben konservative Mächte der Welt ein achtunggebietend Bild gezeigt.
Warum fehlt dem alten Österreich dieser tragische Schimmer, warum vermögen seine Figuren auch nicht das bescheidenste Maß menschlicher Teilnahme zu wecken? Warum tönt ihnen nur ein Riesenfluch, der Fluch aller davonziehenden Völker entgegen? Dieses alte Österreich der Adelsherrschaft, der Exzellenzen und Würdenträger, der Hochgeborenen und Hochgehobenen hat niemals eine Beziehung zum wirklichen Österreich gehabt, nie eine echte Anteilnahme an den Schicksalen der Völker und darum auch kein Verständnis für die Sorgen und Angelegenheiten des Staates. Von ihnen galt bis heute, was Mickiewicz einst vor sechsundsiebzig Jahren in seinen „Vorlesungen über slawische Literatur“ niederschrieb: „Dieses Kaiserreich“, sagt er, „zählt 34 Millionen, im Grunde genommen hat es jedoch nicht mehr als sechs Millionen Köpfe; nämlich 6 Millionen Deutsche halten 28 Millionen anderer Stämme in Unterwürfigkeit. Zieht man aber von diesen 6 Millionen noch die Zahl der Bauern, der Handwerker, der Kaufleute u.s.w. ab, welche gar keinen Teil haben an der Regierung, so bleiben höchstens noch 2 Millionen Österreicher, welche diese ganze Masse beherrschen. Diese 2 Millionen, oder vielmehr deren Interessen und Meinungen, werden von ungefähr hundert Familien repräsentiert, welche deutsch, ungarisch, tschechisch, polnisch, welsch sind, insgemein aber Französisch sprechen und ihre Kapitalien größtenteils außer Landes haben. Indem sie nun zu ihrem Dienste 2 Millionen Bureaukraten und Soldaten verwenden, herrschen sie durch dieselben über die anderen 32 Millionen. Es ist dies eine Gesellschaft nach dem Muster der Englisch-Ostindischen Handelskompagnie, welche auch einen großen Landstrich hat. Gewöhnlich stellt man sich dieses österreichische Kaiserreich falsch vor, das nie ein deutsches, ungarisches, slawisches Reich gewesen, sondern eine Sippschaft von allen ist, die sich das gleiche Ziel gesetzt haben, am Marke so vieler bevölkerter und ausgedehnter Länder zu zehren.“
Das hat vor sechsundsiebzig Jahren ein kluger Pole geschrieben! Seine Ziffern haben sich inzwischen ein wenig verschoben, aber sein Urteil klingt noch heute erschreckend wahr. Kann man es besser ausdrücken, was das alte Österreich gewesen, als mit den Worten von der Ostindischen Kompagnie? War es etwas anderes als eine Domäne der hundert Familien? War es nicht ein schöner Garten, untertan einer rücksichtslos egoistischen Sippschaft? Es ist die größte Infamie und die frechste aller Geschichtslügen, was heute noch aus der Totenkammer der Hochgeborenen zu uns herüberschallt, das Wort von den „zerstörenden“ Kräften eines „überspannten“ Nationalismus, von den „destruktiven“ Elementen des Hochverrats und der Vaterlandslosigkeit. Ah, so leicht wird es die Geschichte den abgedankten Herrschaften nicht machen, sie wird ihnen nicht gestatten, dieses alberne Märchen weiterzuspinnen. Österreich hätte, rechtzeitig von den hundert Familien befreit, ein sehr glückliches, schönes, zukunftsreiches Land werden können; die Natur hat ihm alles gegeben, die Völker waren von Haus aus bescheiden und wahrhaftig mehr als geduldig. Aber der Fluch dieses Landes wurden jene seltsamen Scharen geadelter Emigranten und Vagabunden, die sich nach der Gegenreformation hier festgesetzt und zu schmarotzenden Herren des Landes entwickelt haben. Der alte nationale Adel, den man in Kärnten, Salzburg, Steiermark und nach der Schlacht am Weißen Berge auch in Böhmen gemordet, wäre niemals für jenes nachher so meisterhaft ausgebildete Wiener System zu haben gewesen, das den Völkern die Seele ausreißen und gegen alle Gesetze der Natur einen neuen Menschenschlag züchten sollte. Die beziehungslosen, volksfremden Parasiten mußten Österreich entnationalisieren, um sich selbst oben zu erhalten, sie konnten Nationen nicht brauchen, weil jede Nation das natürliche Streben nach Selbstregierung mit auf ihren Weg bekommt.
Das parasitäre Emigrantentum bildete den Kern der sogenannten hundert Familien. Um ihn gruppierte sich im Laufe der bürgerlichen Entwicklung, durch Versippung und Geldheirat, ein weiterer Familienkranz, der für seine Söhne alle höheren Stellen der Beamtenhierarchie und des Heeres mit Beschlag belegte. Mickiewicz hatte recht, wenn er sagte, daß die Mitglieder dieser Gesellschaft alle Sprachen und doch nur eine Sprache sprachen; sie waren durch noch andere Bande als durch die des Bluts miteinander verknüpft, sie bildeten eine Sekte, dachten stets das gleiche, sie trafen sich überall und verstanden einander, sie hatten dieselben äußeren Merkmale und Abzeichen, und sie kannten nur ein Ziel: Carriere zu machen, sich oben zu erhalten, die Macht nicht aus den Händen zu geben.
Man wird einwenden, daß sich ähnliches überall findet, in monarchischen wie in demokratischen Staaten. Von Deutschland wurde gesagt, daß dort die Junker herrschen, von Frankreich, daß die parlamentarisch-plutokratische Konsorterie das Heft in Händen habe. Aber bei solchem Vergleich wurde etwas übersehen: der herrschende Kreis Preußen-Deutschlands hatte Fähigkeiten, die ihm niemand absprechen konnte; die Gesellschaft, die im demokratischen Frankreich regierte, erneuerte sich ununterbrochen, sie stand außerdem stets unter der schärfsten Kontrolle der Öffentlichkeit und war begabt. Das Merkmal der österreichischen „hundert Familien“ dagegen ist: höchste Unbegabung und völlige Kontrollosigkeit. Ist es denn jemals einem Talent in Österreich möglich geworden, den festen Kreis der Sippschaft zu durchbrechen? Konnte hier jemand emporkommen, der nicht den Stempel der Hundert trug? Und wenn es ausnahmsweise gelang, konnte er sich behaupten? Die Konsorterie hatte Mittel und Wege genug, jeden Unbequemen auf sanfte, und wenn es sein mußte, sehr derbe Art beiseite zu bringen. Seht euch doch um, wer uns regiert hat, blickt in die Ministerien, in die Staatsämter, nehmt die Liste der hohen Beamten und Diplomaten her und ihr werdet nur Angehörige der sogenannten hundert Familien finden. Diese Alleinherrschaft der Sippe konnte sich trotz des Widerstrebens der Völker jahrzehntelang halten, sie konnte Solferino, sie konnte Königgrätz überdauern, aber an diesem Kriege mußte sie zerschellen. Jetzt hat sie auch der Blindeste erkannt. Aber deshalb darf man noch nicht glauben, daß sie nicht früher schon von den Völkern als das eigentliche Übel Österreichs, als der große Fluch dieses Landes empfunden worden wäre. Woher denn sonst dieser fanatische Haß gegen „Wien“, woher die felsenfeste Überzeugung der Völker, daß Wien „hoffnungslos“ sei, daß von dort keine Lösung des staatlichen Problems, keine Besserung, keine Rettung kommen könne? Man hat überall, in Prag und Wien, in Laibach und Agram, das Wesen dieser parasitären Gesellschaft begriffen, die frivol, verlogen, faul und genußsüchtig von einem Tag zum andern lebte und sich ernstlich einbildete, daß die Völker dazu da seien, von den hundert Familien wie Hunde an der Leine geführt zu werden. Es brauchte lange, bis man hinter das Geheimnis der „Ostindischen Kompagnie“ kam, es währte schon eine Weile, bevor man die schöne Fassade herabriß, hinter der sich die nackte Gestalt dieser Gesellschaft verbarg. Aber dann lebte auch der unbezähmbare Haß auf. Man hat hier nie verstehen wollen, warum die Tschechen Wien stets unter Gänsefüßchen setzten, warum sie dieses „Wien“ wie die Pest haßten. Es war der Protest einer Nation, die es nicht länger ertragen konnte, unter der Fuchtel der Ostindischen Kompagnie zu leben.
Die Flaggen, Wimpel und Maskeraden, mit denen diese Gesellschaft ihr Geschäft patriotisch umhüllte, sind vom Wind zerzaust und zerrissen worden. Die Konsorterie selbst steht einigermaßen betroffen da und sucht dem drohenden Bankerott zu entrinnen. In diesem Augenblick taucht eine Gefahr auf, die heute schon zu plakatieren Pflicht aller wirklichen Freunde Deutschösterreichs sein müßte. Es ist gar keine Frage: die slawischen Staaten werden schon dafür sorgen, daß ihnen der Schutt des alten Reiches, der Mist und Dreck des einstürzenden Hauses nicht auf den Neubau falle. Aber wie wird’s mit Deutschösterreich? Was werdet ihr tun, um die Ratten fernzuhalten? Wie werdet ihr euch vor den hundert und mehr Familien schützen? Wie vor den Bankerotteuren der Bureaukratie? Vor den tausenden Nichtstuern, Parasiten, Tagedieben der alten Ordnung? Wie soll man all dies Gesindel, das den alten Staat ins Grab gebracht hat, vom neuen Staate fernhalten? Ach, sie werden kommen, sie werden bei euch einzudringen suchen durch dieselben Türen, die sich sonst öffneten, sie werden Verbindungen, Bekanntschaften, Verwandtschaften spielen lassen, sie werden alles tun, um eines nicht zu verlieren: Einfluß und Macht. Aber wehe euch, wenn ihr ihnen die Türen öffnet, wehe euch, wenn sie einschlüpfen! Eine der hundert Familien genügt, Deutschösterreich zu verderben, denn eine zieht neunundneunzig nach sich. Sie haben Österreich ruiniert, nun werft sie zu den Toten!
[Der Friede, Bd. 2, Nr. 40, 25.10.1918, S. 317-319 (Kajetan).]
Die Vollbartbuben
Einer der wenigen klugen Menschen des alten österreichischen Parlaments sagte einmal von der Politik der Deutschen, man habe stets den Eindruck von Tertianern mit langen Bärten, die Männer mimen. Besser ließe sich das infantile Unvermögen der deutschen Politik kaum ausdrücken. Der Mangel an Wirklichkeitssinn, die kindliche Freude an tönenden Worten und die Überschätzung pathetischer Worte, verbunden mit dem Hang zu Renommisterei – kurz, alle jene Eigenschaften, die der kleinstädtische Bub an sich hat und als Couleurstudent leider behält, dies alles war auch dem deutschen Politiker eigen. Wenn man die charakteristischen Vertreter des deutschen politischen Parterres daraufhin näher besah, konnte man finden, daß ihre Geistesverfassung sich in nichts von der Art dieser pathetischen Jünglinge unterschied. Ihnen erschien das politische Terrain als eine Art Paukboden, auf welchem sehr unklar und rein gefühlsmäßig empfundene Angelegenheiten „ausgefochten“ wurden. Daß politische Tätigkeit vor allem Wirklichkeitssinn, das Erfassen des Wirklichen voraussetzt – diese sehr einfache Tatsache ging sie nichts an. Sehr begreiflich; sie waren wirklich Buben geblieben, Knaben ohne Erlebnis, daher ohne Beziehung zur Wirklichkeit. Und es ist bekannt, wie schwer es wird, einen Knaben, der die Wirklichkeit fürchtet und sich vor ihr in die Winkel seiner Phantasie verkrochen hat, zu einem wirklichen Menschen zu machen. Es geht ihm wie dem Schwimmer, der nicht den Sprung vom Trampolin wagt. (Das Wunder, den Knaben in einen Mann zu verwandeln, gelingt meist nur einem gütigen Frauenarm.)
An den beglatzten Tertianern mit den Vollbärten würde wahrscheinlich auch das holdeste Bemühen scheitern; sie sind viel zu tief in die Phantasien der senil gewordenen Knabengehirne verstrickt, als daß sie den Weg zur Wirklichkeit finden könnten. Kein Wunder, daß die allem Realismus ferne Politik der Wiener Geschichtemacher an den Vollbart-Knaben die begeistertsten Helfer fand. Nachher freilich, als die Katastrophe die simple Wahrheit verkündete, daß die Wirklichkeit sich nicht nach den Phantasien der infantilen Gehirne richte, nachher waren die Knaben einigermaßen verdutzt und klagten Gott und die Welt an. Aber geändert haben sie sich nicht. Man braucht nur heute einen Blick auf die Kundgebungen, Reden und Beschlüsse dieser Politiker zu werfen und wird erschreckend sehen, daß das Knabenspiel von einst unter geänderten Verhältnissen weitergeht. Augenblicklich haben die Tertianer nichts Besseres zu tun, als bei jeder Gelegenheit zu verkünden, daß sie „unentwegt“ und „fest entschlossen“ auf „ihrem Rechte“ verharren, den Anschluß an Deutschland fordern und … Bei diesem „und“ teilen sich die Wege: die einen erheben drohend die Faust und murmeln etwas von „jenem nicht mehr fernen Tage, an welchem …“, die andern aber beschließen, wie in Salzburg, eine Volksabstimmung.
Es ist ewig schade, daß die bramarbasierenden Tertianer, die stets vorgeben, ihr Volk unendlich zu lieben, niemals die Geschichte ihres Volkes studiert, geschweige denn über diese Geschichte nachgedacht haben. Besäßen sie historischen Sinn und den freien Blick für das Tatsächliche der deutschen Geschichte, die leider Gottes von so vielen servilen, loyalen und patriotischen Geschichtsschreibern gefälscht wurde, dann könnte man ihnen heute an der Hand dieser traurigen Geschichte nachweisen, wieviel Unglück die geschichtemachenden Tertianer mit den Vollbärten angerichtet haben. Das Generalverbrechen der deutschen Tertianer, das alles spätere Malheur fortzeugend gebar, waren die sogenannten deutschen „Befreiungskriege“, jenes ungeheure Mißverständnis armer Knabengehirne, die in ihrem Enthusiasmusdunst sich gegen Napoleon kehrten. Ohne Leipzig und Waterloo hätte die Geschichte einen anderen Weg genommen. Doch um bei unserer Heimat zu bleiben: Wenn jemand den biedern Vollbartknaben in Tirol das Unsinnige dieses Kampfes gegen Napoleon vorgehalten hätte, wäre er als „Ententist“ von anno dazumal, als Spion und Schurke erschlagen worden. Noch heute darf man unter Vollbartknaben nicht an die Heiligkeit Andreas Hofers rühren. Dem Tertianer handelt es sich immer nur um die pathetische Pose, er kann es sich also ersparen, darüber nachzudenken, warum Hofer und die Seinen sich so heftig gegen den Anschluß an Bayern gesträubt haben, den Napoleon wünschte. Der tirolische Heldenmut, den die Knödelpathetik des Malers Egger-Lienz vergebens ins Gigantische zu strecken sucht, wäre im Dienste einer politischen Idee sinnvoll gewesen; so wie er war, verpuffte er lediglich zur Freude aller Tertianer. Jedes Vollbartmenschen Auge wird heute noch naß, sobald die Weise ertönt: „Zu Mantua in Banden …“
Die Tertianer sind unverbesserlich. Politik und Geschichte erscheinen ihnen als heroische Abziehbilder. Darum gefallen sie sich jetzt darin, den Gedanken des staatlichen Zusammenschlusses der Deutschen zu einer kindlichen Phrase zu verkitschen. Jeder politisch denkende Mensch weiß, daß es einfach albern ist, vom Anschluß auch nur zu reden; eben deshalb schreien die Tertianer „Anschluß!“ und schlagen dabei die Bierkrügel auf den Tisch. Jeder die Wirklichkeit sehende Mensch weiß, daß es ganz wirkungslos ist, wenn die Deutschen bei irgendeiner abstrakten Macht die Geltung liberaler Ideen und ihr Selbstbestimmungsrecht reklamieren; eben deshalb schwingen die Tertianer Fähnchen mit der pathetischen Inschrift „Selbstbestimmungsrecht!“.
Nebenbei gesagt, liegt eine gewisse Logik darin, daß die sogenannten liberalen Ideen augenblicklich ganz und gar wirkungslos sind; die Deutschen haben sich etwas spät, erst in der Not, an dieses dünne Pflänzlein erinnert! Nun gibt es wohl Leute, die so weit klug sind, zu wissen, daß die Anschlußkomödie aussichtslos ist, die aber dennoch sagen, es sei gut, der Entente zu „drohen“ und den wilden Mann zu spielen. Wir meinen dagegen, daß dieses Spiel – von der Entente und der Wirkung auf die Entente ganz abgesehen – einfach zu kindisch ist. Wenn die Salzburger an einem schönen Sonntag nichts Besseres zu tun wissen, als Papierzettel in Urnen zu werfen, so mögen sie’s immerhin tun; besser wär’s freilich, sie nähmen den politisierenden Tertianern das Spielzeug endlich aus der Hand und zwängen sie, ein ordentliches Handwerk zu lernen. Die politisierenden Buben haben nachgerade genug Malheur angerichtet; es ist Zeit, sie von den politischen Tummelplätzen zu verjagen.
[Wiener Sonn- und Montags-Zeitung, Jg. 59, Nr. 11, 14.3.1921, S. 2 (Kajetan).]
Die Ha‑ha‑isten
Es gibt eine Sorte von Zeitgenossen, die es außerordentlich witzig und geistvoll finden, das eigene Land, unser kleines Österreich zu schmähen; man hört ihr „Ha, ha, ha“ bei jeder Gelegenheit, etwa, wenn es sich darum handelt, einem Uneingeweihten einen beiläufigen Begriff des neuen Österreich zu geben, ihm unsere Verfassung oder sonst eine Einrichtung des Landes zu erklären. Bei einem solchen Anlaß können sich die Witzbolde nicht genugtun; welche Ironie, auf die kleinen Maße des Landes hinzuweisen, die freie, selbstgewählte Form des Landes zu verspotten, oder gar, was solche Tröpfe am liebsten tun, an den Truppen des Landes ihren Witz zu üben! Diese Leute kommen sich dabei sehr überlegen vor und tun sich darauf etwas zugute, daß sie die Katastrophe, die Leiden und Sorgen des Landes, in welchem sie leben, ohne Anteilnahme und Beziehung, kalten Herzens zum Objekt der Ironie machen können. Sie ahnen gar nicht, wie durchsichtig ihre armselige Erhabenheit ist und wie muffig ein Spott, der sich an der Quantität entzündet, ohne ein Auge für das Gute im Kleinen zu haben.
Der Ursprung dieses Spotts ist sehr einfacher Natur: Die Herren Ha‑ha‑isten sind Deklassierte, durchwegs Menschen, die in der alten Monarchie irgendeine Art von Rang und Geltung hatten, dies nach dem Umsturz verloren haben und in der neuen Ordnung der Dinge keine oder nicht die erwünschte Wertung finden können, womit schon gesagt ist, daß die verlorengegangenen Attribute nicht dem individuellen Vermögen, sondern meist irgendwelchen Zufälligkeiten, wie der Geburt, gesellschaftlichen Beziehungen, oder nur den Äußerlichkeiten eines monarchistischen bureaukratischen Staatswesens zu danken waren. Es gibt abgesägte Hofschranzen und hohe Beamte unter den Ha‑ha‑isten, aber auch Türsteher und Lakaien, kaiserliche Räte, die es nie vergessen können, wie herrlich es war, im Kaffeehaus vom Pikkolo also angesprochen zu werden, und Würdetrottel, denen es nicht in den Sinn will, daß jede Art Arbeit gleich achtbar sein kann. Das größte Kontingent der Ha‑ha‑isten stellen aber jene Flachköpfe, denen das Weltbild nichts sagt, wenn es der „Gesellschaft“, dem Tümpel assortierter Eitelkeiten, garantierter Wertschätzungen und der gegenseitigen Anerkennung entbehrt.
Nebenbei gesagt, ist es gut, jeden Ha‑ha‑isten immer wieder darauf aufmerksam zu machen, daß ihnen eigentlich niemand „geschafft“ hat, ihre alte Welt zu zerschlagen; hätten sie in ihrem Übermut, in ihrer Dummheit und Arroganz nicht selbst den ersten Stein geschleudert, dann stünde diese Welt, der übrigens gar nicht nachzutrauern ist, heute noch, und die „Gesellschaft“ könnte sich auf den Tummelplätzen der Eitelkeiten wahrscheinlich wie anno dazumal ergötzen. Jedem freien, vorurteilslosen Menschen, der in der Wirklichkeit lebt und darum den eigenen Wert durch sich und nicht als Geschenk von fremder Hand empfangen – jeder solche Mensch findet sich mit dem Neuen auf seine Art ab, ja, er wird, sofern er nicht vom subjektiven Wahn alter Eitelkeiten befangen ist, trotz der objektiven Schwierigkeiten unseres neuen Daseins vieles finden, das dieses Dasein weitaus besser, menschenwürdiger und darum schöner erscheinen läßt. Es spricht auch für die gesunde, natürliche Art des Wiener Volkes, daß es sich mit so viel bewundernswertem Mut in die neue Lage gefunden und, ganz unsentimental, über dem Heute das Gestern vergessen hat. Wenn man nämlich jenen Schwachköpfen hätte glauben wollen, die ehedem die Legende vom patriotischen Wiener verschleißten, dem die Stadt nur etwas bedeute, weil sie die „Kaiserstadt“ sei, dann müßte Wien heute ungefähr ein ähnlich trostloses Bild bieten, wie es jetzt in Deutschland zu sehen ist, wo sich große Schichten des Bürgertums in historisch-romantischen Krämpfen winden und eine ernste Gefahr für das Reich heraufbeschwören, nur weil ihnen die zerschlagene Welt der Illusionen, der Wichtigtuereien und Rangstufungen wichtiger ist als das neue, wirkliche Dasein, in welches sie sich nicht hereinfinden wollen. Der Wiener ist, insoweit es sich um wirkliche Dinge handelt, durch den Umsturz weit härter mitgenommen worden als der Deutsche; er hat, nach der Hölle des Krieges, noch zwei schreckliche Jahre der Not durchschritten und muß auch heute noch auf sehr viel verzichten, was ein zivilisierter Mensch immerhin doch als Recht beanspruchen darf – trotzdem hat dieser nicht genug zu lobende Menschenschlag den Weg in die neue Wirklichkeit gefunden.
Es ist wichtig, solche Dinge menschlich, naiv zu sehen; wer aber, durch die Phraseologie der Zeit verdorben, allgemeine Angelegenheiten nur erkennt, wenn sie in der Terminologie der Politik serviert werden: den braucht man bloß daran zu erinnern, wie im Grunde krampflos, unbösartig, menschlich Wien die Tage der großen Erschütterungen überstanden hat. Es gehört zu der Verbohrtheit und Schafsköpfigkeit der Ha‑ha‑isten, daß sie stets, wenn von Österreich die Rede ist, Deutschland als Muster und Beispiel heranziehen, genau so, wie sie es vor dem Kriege getan haben, ahnungslos, wohin die Berlin-Anbetung steuert. Was imponiert diesen Dummköpfen an Deutschland? Ist es der deutsche Geist? Den kennen sie nicht. Sind es die außerordentlichen bürgerlichen Tugenden des deutschen Arbeiters, dessen hoher Bildungsgrad und nüchterner Sinn? Nein, den mögen sie nicht. Imposant finden sie nur die Maße, das Quantitative, die materielle Größe und alles Mechanisierte. Aber sie sind blind vor jenem unglückseligen Hang zu einer Lakaienromantik, blind vor den Besessenheiten einer wirklichkeitsfremden Klasse, der das Soldatenspiel und Assessorentum wichtiger ist als die Freiheit und der die Welt nur sinnvoll erscheint, wenn sie die natürlichen Geltungen unterdrückt und an deren Stelle die strengen Rangstufen der Hierarchie, der Würdetrottel und uniformierten Patzigmacher setzt. Das nennen sie „Ordnung“.
Man kann ein sehr guter Deutscher sein, jedenfalls ein besserer Deutscher als die Ludendorff-Anbeter, und doch finden, daß die krampflose, natürliche Art, in welcher das kleine Österreich seine Freiheit empfangen hat, den bösartigen Kämpfen und Morden, unter denen Deutschland erzittert, vorzuziehen ist. Wer nur ein bißchen gerecht und kein unverbesserlicher Schwachkopf ist, der müßte sich sagen, daß der Österreicher heute, weit mehr als jemals, ein Recht hat, auf sein kleines Vaterland stolz zu sein. Ja, bei Gott, die Geschichte hat uns sehr hart gestraft und arg beim Schopf genommen, aber wenn wir, noch inmitten der harten Prüfung, um uns blicken auf jene „Glückspilze“ der Geschichte, die, von hohen Protektoren reich bedacht, an der Wiege ihrer Staaten alle Gaben verschwenderisch empfangen haben, dann können wir nicht anders als stolz sein. Die reich bedachten Glückskinder haben mit den großen Geschenken schlecht gewirtschaftet; sie sind, kaum drei Jahre der so laut reklamierten Selbstbestimmung überlassen, weder glücklich noch frei. Überall in unserem Umkreis wuchert ein böser, fanatischer Geist, es wird gerauft und gemordet, unterdrückt und verfolgt, eingesperrt, konfisziert und gehenkt. Ach, wie anders hat man sich die Zukunft der befreiten Nationen gedacht, wie anders das neue Mitteleuropa unter den Segnungen der Demokratie! Von unseren östlichen Nachbarn ist’s besser, gar nicht zu reden; man kann die Menschen nur bedauern, die verurteilt sind, unter dem blauen Himmel einen Kerker zu haben. Aber die Asiatisierung Mitteleuropas beschränkt sich nicht allein auf dieses fluchbeladene Land; sie schreitet fort und läßt den Gedanken an ein freies Menschentum zu einer Seifenblase werden.
Ist inmitten dieser Welt von Haß und Bosheit, von Fanatismus und Rachsucht, von Gemeinheit und tierischer Grausamkeit – ist angesichts dieser Hölle die bescheidene, aber schöne, helle Freiheit des kleinen Österreich so gar nichts? Haben die Ironiker, die Witzbolde und Schmäher noch immer den Mut, ihr blödes Ha‑ha‑ha zu meckern? Freilich, wem das Freisein, das freie Atmen und das Glück des freien Denkens nichts ist, wer die edle Gesittung dieser Stadt, das natürliche, unpolitische, aber darum echte, physiologische Freiheitsbedürfnis ihrer Bewohner nicht als kostbares Gut empfindet, der mag bei seinem Ha‑ha‑ha bleiben. Er ist nicht wert, unter Wiens glücklichem Himmel zu leben; die politische Ergänzung seines Ha‑ha‑ha heißt: Kaserne, Kriminal, Monarchismus, Wichtigtuerei, Entwürdigung, Lakaientum, Verblödung. An ihrem blöden Lachen werdet ihr sie erkennen!
[Wiener Sonn- und Montags-Zeitung, Jg. 59, Nr. 36, 5.9.1921, S. 4-5 (Karl Tschuppik).]
Solides Geld – solide Sitten
Die Betrachtung über den „Salon Pallenberg“ in der letzten Nummer der „Sonn- und Montags-Zeitung“ hat eine ganze Reihe teils zustimmender, teils ablehnender und empörter Zuschriften veranlaßt, unter anderen auch solche, die beweisen, daß die merkwürdige Sekte der aufdringlichen Pädagogen und Sittenrichter nicht aussterben will. Der Typus ist bekannt. Er begleitet uns durchs ganze Leben. Schon in der Schule hatte jede Klasse zwei, drei dieser widerlichen Knaben, denen auf dem bleichen, freudlosen Gesicht geschrieben stand, daß sie Musterschüler waren und, um es mit den selbstlobenden Worten Franz Moors zu sagen, die Geschichte des bußfertigen Tobias lieber lasen als die Abenteuer Julius Caesars, Alexander Magnus’ und anderer stockfinsterer Helden, lieber daheim an frommen Gebeten und heiligen Predigtbüchern sich erbauten, als mit Gassenjungen und elendem Gesindel auf Wiesen und Bergen sich herumzuhetzen. Wie war ihr Auge stets an den Mund des Lehrers gebannt, wie schweifte ihr Blick nicht einmal zum Fenster hinaus, und die apportierliche Artigkeit, mit der sie auch zu dem schalsten Witz des Lateinprofessors grinsten und sich gefällig zeigten, machte sie abgerichteten Pudeln ähnlich. Die ganze Klasse haßte sie; die schöne Solidarität aller andern war gestört durch ein Element, das mit zwölf und dreizehn Jahren schon die Natur des Konfidenten, des Staatsanwaltes, des Karriereschnaufers und Fartcatchers in sich vereinigte. Ihr giftiges, greisenhaftes Auge blickte scheel und feig auf alle edlen Gassenbübereien der Klasse, auf den Übermut der Zehnuhrpause, auf die lauten und stillen Bekenntnisse der frohen Knabenseelen. Diese von der Gemeinschaft gehaßten und verachteten Musterschüler bleiben im Leben, was sie in der Schule gewesen. Keiner von ihnen bringt es zu etwas Ordentlichem, keiner wird durch Eigenart, Talent oder Tüchtigkeit auf irgendeinem Gebiete auffallen; sie sind zu Bureaukraten, Aufsehern, Moralpredigern, Gefängniswärtern, Polizeibeamten, Registratoren, Steuereintreibern bestimmt.
Vergebens, zu fragen, woher diese Menschenklasse die Anmaßung hernimmt, über andere zu Gericht zu sitzen; vergebens auch, ihnen klarzumachen, daß es dem gesunden, lebensfrohen Menschen niemals einfallen wird, sich abzusondern und seine Art des Daseins und Denkens anderen aufzwingen zu wollen. Der Terrorismus in moralischen Dingen, die Besessenheit im Sittlichen entspringen immer dem Sumpf trüber Musterschüler-Seelen. Darum ist es so schwer, das Urteil sittlich Entrüsteter objektiv zu werten. Der Bucklige muß die Welt und das Leben hassen; der Schweißfüßler, durch seinen Defekt von dem Spielplatz der Geschlechter ausgeschlossen, muß sittlich sein; der Mann mit üblem Mundgeruch tendiert notwendig aus demselben Grunde zum Moralprediger; der Stinker aus innerem Zwang erspart Wäsche und Dampfbad und wird Anwalt der reinen Seele. Wem die Natur einen Klaps gegeben, der sucht irgendwie dieses Minus in ein Plus umzuwandeln. Versuche, wer mag, gegen die Rachsucht solcher Benachteiligter zu polemisieren!
Neben ihnen wirken fast jene Schafsköpfe sympathisch, die aus politischen oder nationalen Motiven das „Volkswohl“ zu bewachen sich verpflichtet fühlen und bald da, bald dort ihr eintöniges „Wehe, wehe!“ herunterleiern. Diese gutmütigen, aber umso langweiligeren Sittenapostel reden den Wienern zu, bescheidener und sparsamer, fleißiger und nüchterner zu werden. Alles recht schön. Aber sie übersehen in ihrer Einfalt, daß jene schätzenswerten Eigenschaften, die man „bürgerliche Tugenden“ nannte, nicht aus den Wolken eines immanenten Moralhimmels kamen, sondern einen sehr realen Untergrund hatten: die Basis eines soliden Geldes. Bei einzelnen Menschen mag’s wohl der Fall sein, daß ihr Verhalten von sogenannten Grundsätzen mitbeeinflußt wird. Im allgemeinen aber erfolgt dies durch die realen Verhältnisse des täglichen Daseins. Solange es ein solides Geld gab, war das Sparen zweckvoll; bei einer Geldwirtschaft, wo sich der gesparte Wert täglich verkleinert, der Sparer also gewissermaßen für seine Tugend durch Verminderung seines Besitzes bestraft wird, hört das Sparen auf. Das unsolide, verfälschte Geld hat aber auch noch andere Wirkung: Es zerstört das Gefühl der Sicherheit, es erzeugt in ängstlichen Gemütern jene viel bemerkbare Hysterie, die zwischen Lustigkeit und Melancholie hin und her schwebt, in phlegmatischeren Naturen aber jenen Hang zur Wurschtigkeit, der in die Maxime ausklingt: „Es is’ schon eh alles eins!“ Gerade jene gutgläubige, brave Schichte des Kleinbürgertums, die gewöhnt war, mit festen Begriffen und festen Zahlen zu rechnen, mußte durch die Verfälschung und Entwertung des Geldes aus dem Geleise des gewohnten Denkens geschleudert werden. Die albernen Moralschwätzer, die in der Mehrzahl ihr Schäfchen im trockenen haben, sollten doch bedenken, daß diese treuherzigen Menschen, die man nun als moralisch verfallend konterfeit, mit dem guten Geld ihren besten Stock, die feste Stütze verloren haben, an welcher sie durchs Leben schritten.
Das Beste an der Sache aber ist, daß die moralischen Maulaufreißer, daß die gutmütigen wie die boshaften Sittenprediger allen Grund hätten, vor allem mit sich selbst vor Gericht zu sitzen. Denn just sie, diese beamteten Herolde der sittlichen Forderung, sind eine der Ursachen der fortschreitenden Geldverfälschung und Geldentwertung. Soviel man uns auch erzählen mag von den Hilfsmitteln der kommenden Tage – Tatsache ist vorderhand, daß wir täglich rund zwei Milliarden neuer Papierkronen drucken müssen, um das Defizit des Staatshaushalts zu decken. Von diesem Neubedarf, der den Notenumlauf täglich vermehrt, geht rund eine Milliarde für die Verwaltung auf. Wir sind nicht antik-grausam genug, die Forderung aufzustellen, daß man alle Schmarotzer am Staate von heut auf morgen um ihr Brot bringen soll. Aber eines möchten wir den patentierten Sittenrichtern doch zu erwägen geben: Wenn man die Dinge ändern, wenn man die Sitten solider gestalten will, dann muß man erst einmal das Geld wieder solider machen! Und das Geld kann man nur festigen, „stabilisieren“, wenn man den Staatshaushalt in Ordnung bringt, was ohne Beseitigung der am Staate Schmarotzenden nicht möglich ist. Eine österreichische Moral müßte also damit beginnen, jede Form beamteten Schmarotzertums als den gröbsten moralischen Defekt zu erklären; es müßte als unanständig, diffamierend gelten, sich von diesem armen Staat aushalten zu lassen. Solange dies nicht der Fall ist, hat die beamtete Maulaufreißerei kein Recht, sich um die Moral der andern zu kümmern. Die Menschen der Privatwirtschaft sind, wie immer sie sonst sein mögen, darin allen Beamteten voraus, daß sie den Staat nicht belasten. Sie nehmen ihm nichts, sie müssen ihm geben. Die Frage der öffentlichen Moral ist ein Problem der Finanzwirtschaft des Staates.
[Wiener Sonn- und Montags-Zeitung, Jg. 60, Nr. 16, 17.4.1922, S. 4-5 (Karl Tschuppik).]
Die Rache des Trottels. Zu den Exzessen der deutschen Studenten in Prag
Es ist höchste Zeit, eine grobe Lüge zu berichtigen, eine Lüge, die im alten Österreich zum Schaden aller geduldet wurde, aber auch heute noch unter veränderten Verhältnissen fortwuchert: die Lüge vom deutschen Studenten in Prag. Das Bild, das die Welt von diesem Musensohn empfangen hat, war ein Produkt der liberalen Ära; in den Tagen, da die liberale Bourgeoisie die Politik der Deutschen in Böhmen regierte, stand auch die Prager deutsche Universität unter der Einwirkung einer geistigen Minorität. Wie an allen deutschen Hochschulen wurde zwar auch an der Prager Universität, die sich mit Stolz „die älteste“ nannte, dem historischen Possenspiel mehr als genug Zeit geopfert, daneben aber war doch noch jene Tradition aus den besseren Zeiten deutschen Studententums lebendig, die den Zusammenhang mit der Geschichte des deutschen Geistes aufrecht hielt und den akademischen Bürger davor bewahrte, einesteils ein armseliger Tropf von Berufsstudenten, andernteils ein verrohter Saufbruder zu werden. Diese Situation änderte sich indes vollkommen, als mit der Verdrängung der Gebildeten aus der Politik die politische Führung der Deutschen in Böhmen an den kleinbürgerlichen Radauantisemitismus überging. Hatten einst die Gebildeten des Bürgertums, Advokaten und Ärzte, Professoren und Industrielle, das politische Leben und damit auch das Denken der studierenden Jugend bestimmt, so erschienen jetzt ganz neue Repräsentanten auf dem Plan: die Stammgäste aus den Bierbeiseln deutschböhmischer Provinznester, politisierende Stadtschreiber, verdorbene Handwerker, die sogenannten Schriftleiter aus den Winkelblättern kleiner Städte, durchgefallene Studenten, die als politische Wanderlehrer ihr Fortkommen suchten, kurz, jene trostlose Gesellschaft, die mehr als zwei Jahrzehnte „deutsche Politik“ in Österreich gemacht hat. Ihr Erfolg war auch danach; wollte man die Schuldigen suchen, die das alte Österreich heruntergebracht und die Wirkung der Vernunft völlig unmöglich gemacht haben, dann müßte man vor allem jener Allianz von Dummheit, Arroganz und Verrohung gedenken, die sich im deutschen Lager zusammengefunden hatte.
Diese Phalanx wäre allein schlimm genug gewesen; das Unglück wollte es aber, daß sie einen mächtigen Bundesgenossen fand: die Wiener liberale Presse. Es wäre vergebens, den antisemitischen Schafsköpfen zu erklären, was diese Presse an den sudetendeutschen Radaunationalismus band; sie werden es nicht glauben, weil ihnen das Organ dafür fehlt. Ein großer Teil der Wiener liberalen Journalisten und Zeitungsmänner von den Zeiten der Lecher, Bacher, Benedikt und Singer bis in die jüngsten Tage stammte aus Böhmen und Mähren; sie hatten nicht nur die deutsche Bildung als das große Kulturelement kennengelernt, sie alle hingen mit schwärmerischer Liebe und Treue an Kindheits- und Jugenderinnerungen; die so schlecht gelohnte jüdische Sentimentalität, die Hinneigung zur alten Heimat, aber auch der höchst deplacierte falsche Ehrgeiz, einer „politischen Bewegung“ zu dienen, hat die Wiener liberale Presse verleitet, Anwalt und Schirmherr einer der schändlichsten Lügen der Geschichte zu werden. Es war eine Lüge, einen Pöbelaufstand mit der Gloriole nationalen Heldentums zu umgeben; ein Verbrechen, den Rache- und Machtbedürfnissen der rückständigsten Elemente geistige Hilfe zu leihen. Der sudetendeutsche Plebejeraufstand hatte das nächstliegende Kostüm gewählt; die Rebellion des Trottels gegen Geist, gegen besseres Fortkommen in der Welt, gegen soziale Höherwertigkeit maskierte sich national. Die Rebellierenden konnten doch wohl nicht die Wahrheit sagen, sie konnten nicht „im Namen des Trotteltums“ Rechte fordern; der Zufall, daß sie Dialekte, häßliche, korrumpierte Dialekte der deutschen Sprache sprachen, erlaubte ihnen, sich „Deutsche“ zu nennen und die – sprachlich übrigens alberne – Aufschrift „deutschvölkisch“ auf ihre Fahne zu heften. Daß diese Bewegung niemals national gewesen ist, geht aus einer einfachen Tatsache hervor: ihnen war der Begriff der Nation überhaupt nicht gegenwärtig, sie haben niemals im Sinne naiv-nationaler Völker an die Gemeinsamkeit aller Deutschen gedacht, sondern stets nur an den Staat, an den österreichischen Polizeistaat, dessen Gunst und Vorrechte zu erwerben das Um und Auf dieses lächerlichen Spektakels bildete. Der „Tscheche“, den sie den nationalen Gegner nannten, erschien ihnen als Konkurrent staatlicher Stellen. Der echte Haß aber richtete sich immer nur gegen den höherwertigen Menschen, gegen den Gebildeten, gegen den Bourgeois, gegen den Juden.
Wär’s anders, der Exzeß der Prager deutschen Studenten bliebe unerklärlich. Macht, Größe, wirtschaftliche und intellektuelle Bedeutung der Deutschen in Böhmen sänken bei Abzug des jüdischen Beitrages auf einen winzigen Bruchteil ihrer heutigen Werte herab; die deutschen Banken, die Industrie des Landes, der Handel sind zu zwei Dritteln in jüdischen Händen. Was aber wäre das deutsche Prag ohne Juden? Die Krawallmacher, die mit Hottentottenlärm wider den jüdischen Rektor der Prager deutschen Universität losziehen, ahnen wohl gar nicht, welches Los ihnen bevorstünde, wenn die deutschen Juden ihre Hand vom Prager Deutschtum wegzögen? Ihnen allen, die mit leeren Händen und vollen Mäulern das antisemitische Heldenspiel mimen, bliebe nichts anderes als die Diurnistenlaufbahn in tschechischen Staatsämtern, wenn sie nicht in völlige Barbarei versänken. Denn vor diesem Schicksal haben sie bisher nur die deutschen Juden bewahrt. Was im deutschen Prag mit deutscher Kultur, mit Bildung und Bedürfnissen der Zivilisation zusammenhängt, ist jüdischen Ursprungs: das Theater, das noch immer auf einer ansehnlichen Höhe steht; die großen Zeitungen; die Bildungsvereine; die humanen Anstalten – alles verdanken die Prager Deutschen jahrzehntelanger Treue und Arbeit der deutschen Juden. Die Frage, was die andere Seite für das Prager- und für das Sudetendeutschtum getan, bringt einen in die größte Verlegenheit. Man wird nicht einen namhaften Mann, nicht ein Werk zu nennen vermögen; ja, selbst die eine Zeitung, die man als den Anwalt der Krakeeler ansehen darf, wird von Juden gemacht.
Dieses Detail freilich gibt auch den Fingerzeig zum Verständnis: die antisemitische Rebellion der deutschen Studenten ist die Rache des Trottels, der dem Gefühl der Minderwertigkeit zu entrinnen sucht. Und es ist wichtig, es wirkt aufklärend, daß er so eindeutig die Maske lüftet. Das Geschwätz und Geschrei von „nationaler Unterdrückung“ war Maskerade: den tapferen deutschen Studenten geniert es gar nicht, daß der Staat seine Institute und Lehranstalten benachteiligt, daß er national zurückgesetzt und in seinen kulturellen Bedürfnissen auf ein Mindestmaß herabgesetzt wird: der Berufs- und der Saufstudent wird, wie er es im alten Österreich gewesen, auch im tschecho-slowakischen Staat ein folgsamer Polizeiknecht und Diurnist werden; sein Nationalismus ist die größte Lüge. In leidenschaftliche Aufwallung, in Rage und Aufruhr bringt ihn nur die Tatsache, daß über ihm eine geistige Welt existiert, die ein jüdisches Antlitz trägt. Die Rache des antisemitischen Trottels ist eine Rache am Geist.
[Wiener Sonn- und Montags-Zeitung, Jg. 60, Nr. 45, 20.11.1922, S. 4 (Karl Tschuppik).]
Die nackte Tänzerin und der keusche Kritiker
Es ist etwas Erfreuliches zu melden: in einer Zeit, da Theaterdirektoren, Konzertunternehmer, Manager, Künstler und Rezitatoren die Müdigkeit des Publikums beklagen, gelingt es eines Abends, den größten Saal Wiens, den großen Konzerthaussaal, bis auf den letzten Platz zu füllen. Ein Blick in den Riesenraum verrät, daß die totgesagte Zweimillionenstadt noch immer mit den andern Zentren wetteifern kann: es ist ein angenehmes Bild, viele schöne Frauen und eine Gesellschaft zu sehen, deren äußerem Gehaben man es anmerkt, daß sie der alten Freude am Schönen nicht entsagt hat. Ein solches Bild ist selten geworden; kein Theater, kein Konzert vermag es heute zu bieten. Das Wunder gelang einer schlanken Tänzerin: Fräulein Anita Berber.
Wer einfachen Erklärungen aus dem Wege geht, mag darüber grübeln, warum gerade die zwei Worte „Anita Berber“ eine so starke Anziehungskraft besitzen; die pädagogisch veranlagten Köpfe werden um eine Antwort wahrscheinlich nicht verlegen sein und zum soundsovielten Male das abgeleierte Lied vom verfallenden Geschmack hersagen, dem ist zu danken sei, daß zwar „ernste“ Kunst vergebens auf Gäste warte, die Spekulation auf den „Kitzel der Sinne“ dagegen sich bezahlt mache. Andere wieder, sittlich Entrüstete, werden auf das Plakat hinweisen, das „Tänze des Lasters“, „Tänze des Grauens“ ankündigte und dadurch die stärkste Lockung übte. Solchen Betrachtungen gegenüber muß man das Publikum in Schutz nehmen. Es ist erfreulich, daß es sich weder von dem Geschwätz der Pädagogen noch von dem Surren der Entrüsteten irritieren läßt, sondern seinem Instinkt folgt, der in diesem Falle die Gewißheit gab, das Vollkommene, das Vollendete zu sehen. Ja, man wußte es, Anita Berber werde sich allen Augen zeigen, wie Gott sie erschaffen hat. Gab es an diesem Abend in Wien etwas gleich Vollendetes, etwas Vollkommeneres zu sehen? War die Erwartung nicht berechtigt? Konnte von all jenen, die an diesem Abend Besonderes, Ungewöhnliches, Schönes sich versprachen, auch nur einer mit dem Geschenke Anita Berbers wetteifern?
Die Erwartung war berechtigt; die schlanke Tänzerin trat in einem königlichen Brokatmantel vor das Publikum, hoheitsvoll, wie aus einer anderen Welt, selbstsicher und selbstverständlich, ließ den feierlichen Mantel von den Schultern fallen und war nackt. Dann tanzte sie, und einigen tausend Augen war es eine Stunde lang vergönnt, die schöne, schlanke Frau sehen zu dürfen. Das Publikum – man sah es ihm an – verabschiedete sich nach überlautem Beifall wie ein dankbarer Gast, der sich beschenkt fühlt. Nicht eine Stimme der Unzufriedenheit oder Enttäuschung; Vollendetes beglückt.
Da meldet sich nun in einem Wiener Blatte ein Mann und sucht diesen Abend in unflätiger Sprache zu beschmutzen; er spricht in einem Ton, dessen sich Kutscher schämen würden; er sagt nämlich, er wäre angesichts der Darbietungen am liebsten auf das Podium gesprungen und hätte dort „Tänze des Speiens“ aufgeführt. Der Mann ist, so versichern seine Kollegen, „Kritiker“. Er zeichnet mit „K“. Daß Menschen dieses Kalibers „Kritik“ üben dürfen in einer Stadt, die ehedem die Auszeichnung genoß, als Stätte eines literarisch verfeinerten Geschmacks neben Paris genannt zu werden, ist eine Sache für sich. Darüber sollen sich die Zeitungsleute untereinander unterhalten. Aber es ist notwendig und wichtig, zu fragen, woher solches Plebejertum den Mut nimmt, die Mediokrität seiner Augen und Sinne als Richtmaß aufzustellen? Er gehört nämlich nicht etwa zu jenen sittlich Entrüsteten, denen der Anblick des Nackten als Sünde erscheint; der Mann ist kein Katholik, kein Frömmling. Er tut zwar so, als ob ihn das Musikalische am Tanze chokiert hätte, zum Schluß aber läßt er diese Maske fallen und stellt sich als das vor, was er ist: als der körperlich und seelisch defekte Diurnist, der das Vollendete ehrlich haßt, weil es sein Widerpart, der unerreichbare Gegenpol seiner selbst ist.
Es wäre nicht wert, so viele Worte an ihn zu verschwenden, wenn der Mann nicht ein Typus wäre. Es gibt heute in Wien einen ganzen Chor dieser bösartigen, dürftigen Diurnistenseelen, die eine trotz ihrem Unglück noch immer dem Schönen zugeneigte, liebenswerte, anmutige, lebensfrohe Stadt schulmeistern möchten. Sie projizieren die Defekte ihres Leibes nach außen, nehmen die Kümmerlichkeiten ihres eigenen Daseins als Maßstab fürs Ganze und fordern, daß die Glücklicheren, Schönen, Freien sich nach den Buckligen, Griesgrämigen, Unfreien zu richten haben. Woher kommt es, daß ein solcher Mensch beim Anblick einer schönen Frau Mißmut, Haß, Neid empfindet? Man braucht nur ihn, seinen Körper und die Weiblichkeit seines Kreises anzusehen! Zwingt diese Menschen, gleich Anita Berber, die Probe aufs Exempel zu machen, und ihr werdet alles wissen! Auf dem Podium der Nacktheit hilft keine intellektuelle Umhüllung, hier gibt es kein Versteckenspiel; entschält diese Diurnisten aus ihrer Umhüllung, zieht sie aus, stellt sie nackt vor euch: mit einem Schlage wird euch alles klar sein. Der Haß der minderen Kreatur gegen das Vollkommenere hat nichts mit sozialem Unmut zu tun; die ärmste Bauernmagd, der hübsche Proletarierknabe werden die Probe bestehen. Nur die Diurnisten nicht. Sie tragen das Schnorrertum im Leibe. Ach, mit welchem Aufwand an Pathos müht sich dieses physiologische Diurnistentum, seine Defekte ins Moralische umzulügen, wie sehr ist es bestrebt, das Schöne, Vollkommenere mit sozialem oder moralischem Schimpf zu bewerfen, als „Sinnenkitzel“, „Luxus“, „Prunk“ und dergleichen zu degradieren. Es ist ein Unglück, häßlich, bucklig, triefäugig, engbrüstig, lebensunfroh, unheiter, verdüstert zu sein; ein Unglück, beim Anblick im Spiegel vor sich selber Ekel empfinden zu müssen. Es ist menschlich und gut, die Welt nicht nach ihren natürlichen Gaben zu sondern und eine Herrschaft der Schönen zu fordern. Aber ganz unmöglich, eine Vermessenheit gegen Gott und die Welt ist, was die Diurnisten anstreben: daß sich die übrigen, die Vollkommeneren, die Gesunden und Freien nach ihnen richten sollen. Der Haß macht die Buckligen und die Schweißfüßler größenwahnsinnig. Statt zu schweigen, üben sie „Kritik“ an den anderen.
Der Herr „K.“, der Anita Berber „bespeien“ will, wird gut tun, seinen versprochenen Tanz im eigenen Heim aufzuführen; aber um Gottes willen nicht nackt!
[Wiener Sonn- und Montags-Zeitung, Jg. 60, Nr. 45, 20.11.1922, S. 5-6 (Kajetan).]
Milch, Brot, Fisolen, Wasser … Das Menü des modernen Heros
Es scheint jetzt Mode zu werden, daß die modernen Heroen ihre Lebensgewohnheiten dem Interviewer direkt in die Feder diktieren: Seht, so lebe ich, nehmt euch ein Beispiel; frühmorgens, bevor die Hähne krähen, aus dem Bett, ein karges Frühstück, dann die Arbeit; nachmittags eine bescheidene Mahlzeit, ein Stückchen Fleisch, etwas Fisolen, als Getränk Wasser, dann wieder die nervenpeitschende Arbeit; abends ein Glas Milch und damit Schluß. Bei Mussolini scheint es, daß er wirklich so lebt, wie er es erzählt. Aber diese Mitteilsamkeit unserer Heroen sollte doch nicht Mode werden. Kürzlich hat ein Volkstribun, der sonst nicht mit Mussolini verglichen werden will, von dem Segen der Enthaltsamkeit und dem Glück des spartanischen Lebens gesprochen. Es klang ähnlich: Milch, Brot, Fisolen, Wasser – aber weniger überzeugend. Denn es leben Zeugen, die wissen, daß der Spartaner vor allem auch das gebratene Gänslein liebt oder zumindest geliebt hat. Ein anderer ließ den heroischen Entschluß verkünden, ab heute käme nur mehr Wasser über seine Lippen.
Solche Mitteilungen, die eigentlich privater Natur sind, könnten immerhin einen Wert haben, wenn sie dem Bedürfnis entsprängen, nützliche Erfahrungen der Physis auch andern bekannt zu geben. Mussolini will an sich erfahren haben, daß Mäßigkeit und Enthaltsamkeit Körper und Geist sehr fromme. Bei ihm klingt die Freude am einfachen Leben wie eine neue Erfahrung; der zu Macht und Ansehen Gelangte erlebte plötzlich die gar nicht so überraschende Wahrheit, daß es angenehm und appetitlich ist, mäßig und sparsam zu sein. Er vergißt nur, seiner Erfahrung hinzuzufügen, daß, um billig leben zu können, man es nicht müssen muß. Der Schnorrer könnte, selbst wenn er wollte, nicht billig leben, weil er alles überzahlt; aber er kann es vor allem darum nicht, weil die Vorstellung des Menschen, der zur Enthaltsamkeit gezwungen ist, nicht bis zum freiwilligen Verzicht reicht. Es gibt aber auch eine Unmäßigkeit aus Melancholie, die sich am gröberen Genuß für die Unerreichbarkeit des Edleren und Schöneren schadlos hält; die Schopenhauer des Magens findet man in Karlsbad.
Die Diktatoren sind für die Mäßigkeit, ihre Widersacher auch. Von rechts und von links wird Wasser und Brot gepredigt. In beiden Fällen mit Berufung auf das Ziel. Bismarck war anders. Bei näherem Einblick in sein Menschlich-Allzumenschliches, das jetzt Emil Ludwigs Buch so anschaulich vermittelt, scheint es fast, daß er im Punkt der menschlichen Dinge der ehrlichste gewesen ist. Er hat seiner Physis keinen Zwang auferlegt. Der Morgen und Vormittag waren ihm lästig. Die Frau mußte den Gatten dreimal wecken, bevor er sich endlich entschloß, mittags, nachmittags das Bett zu verlassen. Auch als Reichskanzler, in Berlin, mitten in Geschäften, hielt er es nicht anders. Moritz Busch, sein journalistischer Vertrauter, bemerkte einmal, die Respektlosigkeit seines Herrn gegen alle bürgerliche Ordnung, gegen Frau und Haus sei anarchistisch; er, Busch, kenne Revolutionäre, die auf der Tribüne die Welt aus den Angeln zu heben versprachen, vor dem Zornruf der Gattin aber sehr artig aus dem Bette sprangen.
Bismarck erwachte allmählich, er aß und trank viel. Neben Mussolinis Menü gehalten, ist Bismarcks tägliche Mahlzeit ein Monstrum: Suppe, Fisch, kaltes Fleisch, Aal, Geflügel, Braten, Enteneier, Nachtisch. Dazu dreierlei Wein, ein schwerer Südwein, viel Bordeaux. Abends schweres Bier und wieder Wein. Erst Schwenninger hat ihn auf eine andere Bahn geführt, zu Frühaufstehen, Leibesübungen, Mäßigkeit erzogen. Aber Bismarck hat dieses Muß, diese Konzession an den Leib als ein Malheur empfunden.
Zugegeben: Schwenninger hatte recht; Bismarcks Lebensweise war nicht klug gewesen. Aber die Heroen von heute, die ihr Spartanertum so prononciert hervorheben, machen sich verdächtig. Sie sprechen zu viel von dem Verzicht auf die Mehlspeise, und das ist zu wenig. Denn schließlich erwartet die regierte, beaufsichtigte, reglementierte Menschheit von den Herren der politischen Macht nicht ein Rezept, wie man ohne Sodbrennen durchs Leben kommt, sondern den Nachweis, wie man freier und unbelästigter leben kann. Und um diesen Preis würde sie ihnen gestatten, zum spartanischen Mahl auch Fisch, Fleisch und selbst ein „Gansl“ zu essen.
[Süddeutsche Sonntagspost, Jg. 1, Nr. 4, 23.1.1927, S. 9 (Dominik).]
Von Metropolis zu Piowati
Die bekannten Berliner Filmregisseure Fritz Lang und Joe May haben in Gemeinschaft mit einigen Finanziers und dem jungen Eisenbach, dem Sohn des Wiener Komikers, auf dem Berliner Kurfürstendamm eine stattlich eingerichtete Filiale von Piowatis Würstelfabrik eröffnet.
Die Tatsache, daß der Schöpfer des Metropolisfilms zu den Würsten gegangen ist, verdient wohl ein paar Worte in der Presse. Nicht wegen der scheinbaren Antithese von Film und Wurst; in der deutschen Filmwelt agieren so viel Leute, die besser täten, mit Würsten zu handeln, daß die Ironisierung des Gegensatzes von Film und Wurst jede Würze verlöre, überdies der Metierwürde der ehrsamen Wurstler grundlos naheträte. Der Sprung vom Metropolisfilm in die Würstelstube ist mehr als die äußerliche Verbindung verwandt gewordener Gegenpole, er zeigt ihre innere Beziehung, ihre Identität auf. Und er berührt dadurch eine ernste Frage, die den Film und das unternehmende Kapital angeht. Der Metropolisfilm war, trotz den verlegenen Worten einer urteilslosen Kritik, das letzte Stück einer Belieferungsphantasie, die bei allem, was sie schafft, in sehr grober Art und mit Verkennung des „Masseninstinkts“ danach fragt, was dem Markt genehm wäre. Nur der Lieferant, der unnaiv zu seinem Werke steht, kommt auf ein so falsches Geleise, wie der deutsche Film mit dem Ungetüm „Metropolis“ geraten ist.
Hier war einer, der sich sagte: Wie wär’s, die zwei Elemente der deutschen Welt, Maschinenbau und Faust, Eisenbeton und faustisches Streben, zu verbinden? Die kalte Spekulation gebar mit heißem Bemühen das „betonierte Gretchen“: Maschinenkonstruktionen ins Phantastische gerückt, ungeahnte Welten eines faustischen Ingenieurs, Gretchen zwischen Riesenturbinen und Betontürmen. Kolossal, was? Das Ganze natürlich fatal. Die Irrealität dieser dilettantisch geschauten Maschinenwelt stieß den deutschen Sachlichkeitsmenschen ab, die Kitschigkeit des Gretchendramas erst recht jeden besseren Geschmack. So simpel ist der Deutsche als Masse denn doch nicht, auch nicht so unnaiv, daß er auf eine solche Lieferantenspekulation hereinfiele. Es ist eben nicht wahr, was kurzsichtige Geschäftsleute meinen, daß man das Publikum durch Erraten seiner Wünsche überlisten könne. Das ist Lieferantenphantasie. Man sieht es an so und so viel Beispielen, auch beim Film: das naiv geschaffene gute Werk siegt über den noch so gewaltigen „Dreh“. (Siehe die Erfolge Chaplins, von „Chang“, der „Rivalen“.) „Hereingelegt“ – nicht im juristischen Sinn, aber als Opfer einer falschen Lieferantenphantasie – wurde in diesem Fall das unternehmende Kapital. So vorsichtig, überlegt, gründlich sonst das Kapital ist, wenn es sich um eine Finanzierung handelt – hier erwies es sich als dumm. Aus einem sehr einfachen Grund: weil es als „Lieferant“ zu denken gewöhnt ist und dem Irrtum unterlag, daß man mit diesem Denken Filmwerke schaffen könne. (Der größte Teil der Kitschfilme kommt auf diesem Wege zustande.) Im Interesse des Filmes und des Kapitals ist dieser Irrtum zu bedauern. Er zeugt miserable Filme und nimmt, da diese Filme Mißerfolge werden müssen, dem Kapital den schönen Wagemut in seinem Verhältnis zu dieser großen, zukunftsreichen Industrie.
Wäre das zeugende Element dieser Filmwelt nicht die Belieferungsphantasie, der Vater der „Metropolis“ hätte nicht so leicht den Weg zu den Würsteln gefunden. Nur wer gewöhnt ist, allem Denken die Taxation der Konsumenten zugrunde zu legen, vermag so selbstverständlich vom Film zu den Würsteln zu springen. Selbst auf diesem Gebiet aber geht es nicht ganz ohne innere Beziehung zum Metier. Auch hier ist es ein Irrglaube, zu meinen, es komme nur auf die Etikette und auf die Quantität an. Das genügt allenfalls zur Befriedigung der gröbsten Bedürfnisse. Die Männer der Spezialitäten, deren Namen, wie Piowati, Theumann, Biel, berühmt geworden sind, haben ihr Metier geliebt, fingen klein an, zogen die Feinschmecker und Kenner an sich und stiegen mit der Wertschätzung ihrer Ware zu Napoleonen der Würstelei auf. Piowatis Würstel waren nicht nach dem Metropolis-Rezept, sondern mit Liebe gemacht. Das unterscheidet die Kunst des Wurstlers von der Wurst der Filmkunst.
[Frankfurter Zeitung, Jg. 72, Nr. 719, 27.9.1927, Abendblatt, S. 1 (Karl Tschuppik).]
Staatsanwalt Schwejk
Der „brave Soldat“ Schwejk, der Held des passiven Widerstands, ist heute eine der populären Figuren der Literatur, wie etwa Don Quichotte. Er dankt seine Originalität, die ihm die Welt als dem Sonderexemplar zuspricht, einer sehr einfachen Tatsache: man kennt seine Heimat zu wenig, weiss also nicht, dass Schwejk kein Original, sondern ein Typus war (geboren aus der widerspruchsvollen Natur des alten Österreich). Die Verneinung des Staats durch Bejahung seiner Gesetze – welcher Nichtösterreicher könnte das verstehen? Man verstand’s als den originellen Ausnahmefall. Es war die Regel. Die Schwejks waren überall. In dem Reiche, wo der Staatsanwalt der einzige Anwalt des Staates war, sass Schwejk auch an dessen Tisch. Doch das lässt sich nur erzählen …
Es war am Tage der Kriegserklärung Österreichs an Serbien. Ich hatte die Leitung des „Prager Tagblatts“. Wir alle waren recht trostlos. Unsere genaue Kenntnis des eigenen Landes machte uns schwermütig. Was sollte werden? Nun aber nützte keine Melancholie! Eben hatte ein Abgesandter der Statthalterei, der obersten Behörde des Landes, die neuen Befehle und Verhaltungsmassregeln für die Presse gebracht. Die Marschroute war vorgeschrieben; adieu, schöne Meinungsfreiheit!
Die Kriegspressezensur trat in Aktion. Jedes Blatt musste, bevor es das Haus verliess, dem Staatsanwalt vorgelegt werden. Was dem Zensor darin nicht gefiel, strich er rot an. Das beanstandete Stück wurde aus der gegossenen Platte mit der Fräsemaschine ausgeschabt, die Platte neuerlich in die Rotationsmaschine gelegt, und mit dem „weissen Fleck“ kam das Blatt wieder zum Staatsanwalt. Erst nach der zweiten Überprüfung durfte es auf die Gasse.
Der Presse standen böse Tage bevor. Alles hing vom Staatsanwalt ab. Der k. k. Staatsanwalt – wir ahnten nicht, wieviel Gesichter er trug. Hätte es nur einen gegeben, den Typus des deutschen k. k. Beamten, dann wär’s ohne angewandte Psychologie gegangen. Der deutsche k. k. Beamte, mit der Erhöhung der Autorität plötzlich sehr streng geworden, war unangenehm, aber man wusste, was und wie. Gefährlicher schon jener k. k. Beamte tschechischer Nationalität, der aus innerer Unsicherheit sich den deutschen k. k. Beamten zum Vorbild nahm. Er wurde noch strenger als sein deutscher Kollege. Immerhin, auch hier wusste man, woran man war. Dann aber kam Schwejk als Staatsanwalt. Und das war so:
Erster Tag der Kriegszensur. Wir mussten in die Kriegstrompete blasen. An der Spitze des Blattes ein Artikel, der von der Unvermeidbarkeit der Ereignisse sprach, an den patriotischen Sinn der Bevölkerung, an das Vertrauen zur alten Armee appellierte. Der Artikel schloss ungefähr: „Unsere Hoffnung begleitet Habsburgs Fahnen … vom besten Geist beseelt … die Truppen setzen sich in Bewegung …“ Es war die vorgeschriebene Sprache.
Das Blatt kommt vom Staatsanwalt mit einem mächtigen roten Strich zurück; der ganze Schlussabsatz muss weg. Es war peinlich, am ersten Tag des Krieges mit einem weissen Fleck zu erscheinen. Waren wir – ein liberales, gut österreichisches Blatt – Hochverräter? Sollten wir schon jetzt das Zeichen des Defaitismus auf der Stirne tragen? Ich rief den Staatsanwalt an. „Was haben wir, verehrter Herr Staatsanwalt, verbrochen, welches Gesetz, welche Vorschrift verletzt?“
Der Staatsanwalt (sehr jovial): „Mein lieber Herr Redakteur, jetzt heisst es jede der Vorschriften genau beachten, ganz genau! Wohin kämen wir! Es ist Krieg! Haben Sie denn nicht gelesen, jedes Wort über Truppenbewegung ist strengstens untersagt …“
Ich: „Sehr gut … ich verstehe aber nicht, wo wir …“
Der Staatsanwalt (mit strenger Stimme): „Auf Ihrer ersten Seite steht: die Truppen setzen sich in Bewegung – das ist Truppenbewegung!“ Niedergeschmettert von dieser Logik hängt man den Telephonhörer ab. So also stehen die Dinge!
Ein paar Tage danach. Das Blatt musste unterm Strich eine Höflichkeitspflicht erfüllen. Einer der Sonderlinge der Familie Habsburg, der als Amateurschriftsteller, Frauenfeind und Geograph auf der Insel Majorka lebende Erzherzog Salvator, hatte ein Buch geschrieben, die Geschichte des Schlosses Brandeis in Böhmen. Das Buch war in unserem Verlag erschienen, man musste es besprechen. Um dem nicht gerade amüsanten Werk eine lesenswerte Seite abzugewinnen, nahm der Referent ein paar Anekdoten heraus, unter anderm auch die Geschichte eines Jagdabenteuers Karls VI., der durch einen Fehlschuss einen seiner Gäste leicht verletzt hatte; der angeschossene junge Baron avancierte zum Obersten eines Reiterregiments und bekam einen Denkstein, der wahrscheinlich heute noch in den Wäldern von Brandeis zu finden ist. Diese harmlose Geschichte wurde harmlos erzählt. Das Blatt kommt mit einem grossen roten Strich von der Staatsanwaltschaft zurück. Das Jagderlebnis Karls VI. ist beschlagnahmt. Wieder ein weisser Fleck! Sehr peinlich. Nun ist der Verdacht, dass wir den Krieg sabotieren, zur Gewissheit geworden. Man ruft den Staatsanwalt: „Dürfen wir erfahren, was an dieser unschuldigen Geschichte staatsgefährlich ist? …“
Der Staatsanwalt (mit einem Schmunzeln in der Stimme): „Mein lieber Herr Redakteur, Sie als Kenner unserer Gesetze sollten wissen, dass ein Mitglied des allerhöchsten Herrscherhauses über dem Verdachte steht, stehen muss, einen Fehlschuss getan zu haben! In einer Zeit, in welcher das Vertrauen zu unserem allerhöchsten Hause wie das Vertrauen zur Sicherheit des Schiessens …“
Ich: „Besten Dank, Herr Staatsanwalt …“
Jetzt wusste ich’s: nicht ich, der Staatsanwalt sabotierte den Staat. Es war Schwejk als Zensor.
[Berliner Volkszeitung, Jg. 77, Nr. 8, 5.1.1929, Morgen-Ausgabe, S. 2 (Karl Tschuppik).]
Gemüt und Gemütlichkeit
In ihrem letzten Buch „Kleine Fanfare“ erinnert Annette Kolb, die Münchnerin, an die „Glanzzeit“ Münchens. Sie meint das erste Jahrzehnt dieses Jahrhunderts. Noch ältere Münchner werden sagen, zu ihrer Zeit, in den achtziger, den neunziger Jahren sei es am schönsten gewesen. Jedoch, in einem hat Annette Kolb recht: keine Stadt war demokratischer. „Alle Scherze waren erlaubt. Der des Dienstmanns zum Beispiel, der sich in einem Witzblatt weigerte, durch den Hof der Residenz zu gehen, mit der Begründung, daß ihn sonst der Prinzregent zu Tische einladen würde … Damals waren die Münchner wirklich unter sich. Die wenigsten kamen weiter als bis Berchtesgaden. Es genügte; das Land war ja so schön! …“ Sie gedenkt des letzten großen Schützenfestes, dieser farbenfrohen, heitern Verbrüderung der deutschen Stämme. Es sprach für die Echtheit des Gefühls, womit die Gäste empfangen wurden, daß die Ovationen abgestimmt waren nach dem Grade der Sympathien. „Kamen die Österreicher heran, so entlud sich ein wildes Freudengeschrei, ein Gejubel, Getose, eine Liebesraserei; auch den Bozenern und Meranern jauchzte man zu; freundlich sah man die Badenser ziehn, die Württemberger …“ Dann, bei den Sachsen, Schlesiern, Mecklenburgern ließ der Jubel nach. „Ich sah“, erzählt Annette Kolb, „einen kleinen Jungen von seinem Vater geohrfeigt, weil er fortfuhr, seine Mütze in demselben Maße wie bei den Österreichern zu schwenken, obwohl schon die Oldenburger an der Reihe waren. Nicht, daß der Vater etwas gegen die Oldenburger gehabt hätte, aber man mußte doch einen Unterschied machen …“ Mag der Vater ein wenig grob gewesen sein, die Münchner Urwüchsigkeit hat ihre Feinheiten. „Es ist die Stadt, in welcher der Einheimische bei der Ankunft ganz von selbst mit dem Bahnhofträger einen vertraulichen Gesprächsstoff anschlägt … fiele das einem Berliner ein?“
Kaum. Es ist eine besondere Art menschlicher Wärme, Gleichtakt der Herzen, eine Demokratie des Fühlens. Man kann sich nicht vorstellen, daß ein Heimkehrer am Anhalter Bahnhof in Berlin zum Träger etwa spräche: „Nu bin ick wieder da, wat macht denn mein Berlin?“ Die entsprechende Antwort könnte nur lauten: „Mensch, dir hat wohl ’n Affe jebissen?“ Die zwei verschiedenen Ebenen des Denkens und Fühlens werden sich nie schneiden.
Die Demokratie des Fühlens ist ein Wert, unabhängig vom politischen Denken. Früher hätte man es einfacher genannt: Menschlichkeit, menschliche Anteilnahme. Eine kleine Szene: In eine Frühstücksstube an der Theatinerstraße tritt eine Bäuerin aus der Umgebung Münchens mit dem Tragkorb auf dem Rücken. Sie verkauft Meerrettich einzeln und in Büscheln. An den kleinen Tischen sitzen Leute der bessern Stände, der Meerrettich hat hier eigentlich seinen Beruf verfehlt. Kaum einer trinkt Bier; es ist eine Stube kleiner Imbisse. Die Bäuerin schaut verlegen umher; sollte niemand Meerrettich wollen? Sie seufzt. Da lädt sie ein alleinsitzender Herr ein, neben ihm Platz zu nehmen. Die Frau mit dem Kopftuch ist gar nicht verlegen. Sie stellt den Korb neben den Tisch und setzt sich. Bloß die Wahl des Getränks fällt ihr schwer. Ein Glas spanischen Weins? Süß oder trocken? Der dicke Rotwein schmeckt ihr, und sie unterhält sich gut mit ihrem Gastgeber.
Nur in einer Stadt, deren Ursprünglichkeit von sozialem Dünkel unberührt geblieben ist, kann man das finden. Überall sonst wird die menschliche Anteilnahme wenn nicht von Hochmut, so doch von einem falschen Schamgefühl zurückgehalten, das sozial unterscheidet und unsichtbare Stacheldrähte zieht.
Selbst Wien, am untersten Grunde seines Völkergemisches München gleich und ihm heute noch in vielem ähnlich, hat nicht diese selbstverständliche Art der direkten Beziehung von Mensch zu Mensch. Der Refrain des alten Wiener Couplets „Menschen, Menschen san mir alle“ hat, wie schon die Fassung verrät, nur außerhalb des Bezirks der Nüchternheit seine Geltung behalten; in [ihrem] Alltagsleben ist die Stadt viel undemokratischer, als man glaubt. Es ist unvorstellbar, daß die gleiche Bäuerin aus der Theatinerstraße in einem Wiener Stadtrestaurant Platz bekäme (ganz zu schweigen, daß sich niemand fände, sie einzuladen).
Annette Kolb spricht von der großen Zuneigung des Bayern zu Österreich. Alle andern Nachbarn, die Franken, Schwaben, Schweizer, seien ihm ziemlich gleichgültig, seine einzige Sentimentalität sei Österreich. „Dem Bayern ist die Liebe zu Österreich angeboren. In dieser Ausgesprochenheit, in diesem Grade und auf diese Weise gibt es wohl kein zweites Beispiel von der Zuneigung eines Volkes für ein anderes.“ Und sie meint, das österreichische Wesen löse in seinem Kontakt mit Bayern dessen liebenswerte Seiten unmittelbar aus. Richtig. Bei diesem Liebespaar ist aber das Gemüt die bayrische Mitgift; der Wiener hat die Gemütlichkeit, was etwas anderes ist. Statt einer Definition soll auch hier eine kleine Geschichte sprechen:
Auf der Wiener Marienbrücke, die den Donaukanal überquert, läuft eine Frau nervös auf und ab; ihr Gehaben läßt befürchten, daß sie aus dem Leben will. Ein Wachmann, der sie im Schatten des Franz-Josefs-Quais beobachtet, nähert sich ihr, faßt sie am Arm und spricht: „Was tun S’ denn da? Schaun S’, liebe Frau, wann S’ jetzt ins Wasser springen, muß ich Ihn’ nachspringen, Sie werden naß, i wer naß. Gehen S’ z’ Haus, und wann’s schon sein muß, hängen S’ Ihna lieber auf! …“
[Süddeutsche Sonntagspost, Jg. 5, Nr. 10, 8.3.1931, S. 4 (Kajetan).]
Banditen im Frack
Die Geschichte des größten Betruges – Der Generalstabschef der Spekulation, Bankdirektor Ehrenfest, auf dem Wege nach Amerika – Die österreichische Regierung schweigt
„… Unter uns lebt eine Sorte von Menschen, die sich während des Kriegs und nach dem Kriege enorm vergrößert hat: die Macher. Das sind Menschen, die man fälschlich unternehmungslustig nennt, sie sind aber nur dreist: Akrobaten der Industrie und Finanz, Zusammenscharrer und Hamsterer von Unternehmungen, deren Bereich vom Zement bis zur Schokolade reicht, vom Schwersten, dem Blei, bis zum Leichtesten, der Kunstseide. Wahre Cagliostros der wirtschaftlichen Welt, jonglieren sie mit ihren zahllosen Kettengesellschaften, die alle nur Vermummungen ein und desselben Geschäftes sind. Mit ihren Aufsichtsräten, die aus bloßen Puppen zusammengesetzt sind, beaufsichtigen und beraten sie nichts. Ihre blendenden Bilanzen bestehen aus erdachten Ziffern. Diese Industrieritter, diese Schänder des Volksvertrauens, sind die eigentlichen, die gefährlichsten Feinde des Staates, und das Zuchthaus ist zu milde für sie. Für das unendlich Böse, das sie verursachen, für ihre Aussaat von Verderben und Elend verdienten sie den Tod! Im Volke muß wieder bewußt werden, daß man es nicht ungestraft betrügen und bestehlen, daß man seine schwer ersparten Groschen nicht ungestraft vergeuden darf. Den Galgen für die Diebe und Betrüger!“
Mussolini am 21. Oktober 1931
Wer spricht so? Aus wessen Stimme klingt so vernehmlich der Zorn des beleidigten Rechtsgefühls? Ist es ein deutscher Staatsanwalt, der endlich die Anklage in Sachen Lahusen erhebt, den Fall „Favag“ geißelt oder den Herrn des Schultheiß-Pratzenhofer-Ostwerke-Konzerns, Ludwig Katzenellenbogen, vors Gericht zitiert? Ist’s ein Anwalt der österreichischen Justiz, der den Direktor der Wiener Credit-Anstalt, Fritz Ehrenfest, konterfeit? Nein – auf deutschem Boden mahlen die Mühlen der Gerechtigkeit sehr langsam, und die Staatsanwälte sind schüchtern, wo es sich um die Eskamotagen der großen Herren handelt. Die zitierten Worte gegen die „Schänder des Volksvertrauens“, gegen die „Cagliostros der wirtschaftlichen Welt“ hat Mussolini in seiner Rede vom 21. Oktober 1931 gesprochen. Als ein paar Verderber der kaufmännischen Moral das zarte Gebilde des allgemeinen Vertrauens zu zerstören drohten, ließ Mussolini keinen Zweifel darüber, daß die staatliche Autorität fest entschlossen sei, mit den Banditen im Frack kurzen Prozeß zu machen.
Er griff zu, und es nützte den italienischen Lahusens, Ehrenfests und Katzenellenbogens nichts, sich mit den ersten Anwälten des Landes zu wappnen. Die Aostos und Campobassos wurden gefaßt! Es bedurfte dazu keiner Notgesetze, keiner besondern Gesetzeskonstruktion. Das einfache Recht, wirksam gegen kleine Diebe, schritt unnachsichtlich auch gegen die großen Gauner ein. Die Aostos und Campobassos mußten in den Kerker. So hat Mussolini beim ersten Demolierungsversuch das Vertrauen des Volkes gerettet und weiteres Unheil verhütet.
Die Krise, unter der wir schmerzvoll leiden, ist die Folge einer plötzlichen Flucht des Spargelds aus den Banken und Industrieunternehmungen. Das Datum des Katastrophenbeginns ist unbestritten. Die „Frankfurter Zeitung“ spricht in ihrer Gedenknummer vom 29. Oktober nur die historische Wahrheit aus, wenn sie schreibt: „Am 13. Mai dieses Jahres, als die Österreichische Credit-Anstalt ihre wahre Lage offenbarte, begann die Weltwirtschaftskrise in eine Kreditkrise überzugehen.“ Das war das furchtbare Unheil! Die reine Wirtschaftskrise breitet sich langsam aus, sie faßt die schwächern Länder zwar härter an als die kräftigern, aber sie teilt sich allen mit und läßt die Möglichkeit gemeinsamer Abwehr offen. Die Kreditkrise kommt wie ein Orkan. Sie reißt mit rasender Geschwindigkeit das ganze Gebäude der Kreditwirtschaft zusammen. Sehr verständlich! Worauf ruht denn dieser kunstvoll verzweigte Bau? Auf dem Vertrauen der Sparer! Millionen Menschen, die sich plagen, gottergeben an einen Sinn im Weltganzen und darum auch an die Gültigkeit der Moral und der gesellschaftlichen Ordnung glauben, tragen ihre Ersparnisse in die Bank. Sie wollen damit vor allem sich nützen, für schlechte Zeiten und fürs Alter vorbauen; sie nützen aber auch den andern. Denn dieses Spargeld arbeitet. Mit ihm kann man Industrien schaffen, Kaufhäuser errichten, Schiffe in Bewegung setzen, Millionen Menschen zu Verdienst verhelfen. Die Arbeit trägt Zinsen. Das Kapital vermehrt sich, jedes Sparers Sümmchen wächst. Diese im Grunde sehr einfache Ordnung – sie klingt heute schon wie ein Märchen! – galt in der guten Zeit des Kapitalismus als etwas Selbstverständliches. Sie war einfach und großartig zugleich. Die Banken zogen wie Riesenmagnete aus Millionen kleinen Börsen die Ersparnisse an sich. Die anziehende Kraft, der Magnetismus, der die Wunder der Welt schuf, war: das Vertrauen der kleinen Leute. Der kleine Mann hatte die Gewähr, daß sein Geld gut aufgehoben, daß es sicher sei und wachse. Ohne diesen Glauben gibt es kein Sparen und kein Kreditsystem. Ohne dieses sichere Gefühl, daß das ersparte Geld in reinen Händen ruhe, gibt es keine kapitalistische Ordnung, keinen bürgerlichen Staat, keine freie Wirtschaft. Ohne das Vertrauen des kleinen Mannes gibt es auch kein Kreditverhältnis von Land zu Land. Denn ein Land kann dem andern nur borgen, solange ihm selber von den eigenen Sparern geborgt wird. Amerika borgt Deutschland – das heißt: Amerikanische Banken mit so und so viel Spareinlagen kleiner Leute lassen ihr Geld in Deutschland verzinsen. Sie können es nur verborgen, weil die Einleger Vertrauen haben.
Nun ermesse man, was es bedeutet, wenn dieses kunstvolle Gespinst, dessen lebendige Substanz das gegenseitige Vertrauen ist, an einem Punkte erschüttert wird! Das Kreditsystem ist kein toter Teppich, den man zur Not stopfen kann, wenn ein Loch eingebrannt wurde. Das Feuer des Mißtrauens breitet sich im Kreditsystem mit jagender Eile fort; plötzlich sind alle Fäden zerstört, das Gespinst ist vernichtet.
Haben die Männer, denen unser Wohl und Wehe anvertraut ist, von dieser simplen Wahrheit nichts gewußt? Waren sie blind? Oder haben sie gemeint, daß das Fell des brav vertrauenden Volkes dick sei wie Rhinozeroshaut? Der Anfang der schweren Krise Deutschlands, der Zusammenbruch der Wiener Credit-Anstalt, hat eine Vorgeschichte, und wer sie kennt, der kann sich nur wundern, wie groß das allgemeine Vertrauen gewesen ist, wie lange es gebraucht hat, bis dem Sparer endlich die Geduld riß. Man müßte eine Geschichte schreiben: „Die Geschichte des Sparers 1918–1931“. Es wäre die Geschichte der frechsten Ausplünderung, des größten Betrugs, des gigantischsten Diebstahls. Mit dem Verlust seiner Ersparnisse nach dem Umsturz hatte sich der brave Mann abgefunden. Er hatte sein Geld in Kriegsanleihe verwandelt, patriotisch denkend, dem Vaterland zum Siege zu verhelfen. Nach der Niederlage stand er trauernd am Grabe aller Hoffnungen. Er begann von neuem zu arbeiten und zu sparen. Jetzt aber überfiel ihn eine Horde wilder Bestien. Sie nahmen ihm alles weg, was er aus der Sintflut gerettet hatte: Haus und Hof, die letzten Waren, seine Möbel, seine Kleider. Um beim Beispiel Wien zu bleiben: die Wiener Inflationsjahre waren ein einziger Raubzug, begangen an dem vertrauenden Menschen. Während das Bürgertum verarmte, wuchsen Schwindelbanken empor, und ein ganzes Korps von „Machern“, türmte neue Reichtümer zu nie gesehener Höhe.
Damals hatte Fritz Ehrenfest sich den Ruf des „genialsten Kopfs“ der Wiener Credit-Anstalt erworben. Seine Genialität bestand darin, im Gegensatz zu der großen Mehrheit der Vertrauenden, nicht vertraut zu haben. Er verstand früher als die andern, daß die österreichische Krone rutschen werde. Und er baute vor. Er verschob Riesenvermögen ins Ausland. Sein eigenes Geld und jenes des Wiener Hauses Rothschild. Die Rothschilds genossen eine Unantastbarkeit wie ehedem der Kaiser. Als Vertrauensmann der Rothschilds und der Credit-Anstalt war auch Ehrenfest unantastbar. Die großen Schieber Wiens hatten aber noch ein übriges getan, sich die volle Freiheit des Verschiebens zu sichern. Wie Camillo Castiglioni besaß auch Ehrenfest einen eigens gebauten Salonwagen, mit dem er zwischen Wien und Amsterdam hin und her fuhr. Die Kontrollorgane an der Grenze, die den kleinen Passagier nach Noten durchsuchten, wagten gar nicht, die Salonwagen der großen Herren zu betreten, und wenn einer so vorwitzig gewesen wäre, hätte er nichts gefunden; dafür hatten die Erbauer der Salonwagen schon gesorgt.
Diese Transaktionen haben den Grundstein zu Ehrenfests Riesenvermögen gelegt und ihm überdies den Dank vom Hause Rothschild für alle Zeiten gesichert. Von da an war ihm eine besondere Stellung in der Credit-Anstalt eingeräumt. Er durfte als Generalstabschef der Spekulation schrankenlos walten. Kein Zweifel: Zeit und Umstände kamen diesem Talent entgegen. Es ist aber außer Frage, daß der vom Glück verwöhnte, so plötzlich zu phantastischem Reichtum gekommene Mann an seiner Hemmungslosigkeit gescheitert wäre. Das Glück blieb dem Hause Rothschild jedoch weiter treu. Das im Inflationsrausch toll gewordene Wiener Spekulantentum hatte sich damals in den Kopf gesetzt, den heimatlichen Raubzug auswärts fortzusetzen und die Beute ins Gigantische zu steigern: es konterminierte den französischen Franken. Die Genies der Wiener Börse waren Meister der Inflationstheorie geworden und überzeugt, daß nach der Krone, nach der Mark der Franken sterben müsse. Vom Rettungswerk Morgans für Frankreich, das sich hinter geheimen Wänden vollzog, wußten in Wien zwei Häuser: die Rothschilds, vermöge ihrer internationalen Verbindungen, und das Bankhaus Cux und Bloch, vermöge seiner Verbindung mit den Berliner Mendelssohns.
Rothschild und sein Generalstabschef hätten Wien und Österreich retten können. Wien war nach Paris der zweitgrößte Börsenplatz des Kontinents geworden; Mammutsummen waren gegen den Franken engagiert; das Kapital der meisten Wiener Banken, also auch die Subsistenzmittel der österreichischen Industrie und des Handels. Rothschild und Herr Ehrenfest taten es nicht. Sie behielten den „richtigen Tip“ für sich. Nach der Rettung Frankreichs durch Morgan hatten Wien und Österreich einen zweiten Krieg verloren. Diese Niederlage war größer als die Niederlage Habsburgs. Von dem Schlag, der von einem Tag auf den andern erfolgte, hat sich Wien nie mehr erholt. Es ist seither eine vernichtete Stadt. Es ging an der Spekulation zugrunde.
Ehrenfest aber war ganz oben, sein Reichtum unermeßlich. Er erhielt den „Pour le Mérite“ vom Hause Rothschild. An die übrigen Banken trat der Tod heran. Es starb – um nur die Großen zu nennen – die Lombard- und Escomptebank, die Depositenbank, die Verkehrs-Bank, die Anglo-Bank, die Union-Bank. Der hohe Turm der österreichischen Effekten stürzte zu einem armseligen Hügel zusammen. Die Aktionäre verkauften ihre Papiere als Packpapier auf dem Naschmarkt. Die Einleger der zusammengekrachten Banken standen vor den Bankpalais Schlange. Die Polizei sorgte dafür, daß die Herren Bankdirektoren nicht durch die Verzweiflungsschreie ihrer bestohlenen Sparer gestört würden.
Und dennoch wurde wieder gespart. Dennoch trugen brave kleine Leute ihre sauer verdienten Groschen in die Bankpalais! So groß, so unermeßlich groß war das Vertrauen der Menschen! Dabei unternahm die Justiz nichts, die verantwortlichen Leiter der Geldinstitute, die das ihnen anvertraute Geld in wüster Spekulation vertan hatten, zur Rechenschaft zu ziehen. Viele der Banditen waren zwar selber Bettler geworden, aber selbst die Liquidierung der ausgeplünderten Banken vollzog sich in der schamlosesten Raubritterart. Der Staat griff nicht ein. Niemand stand auf, das kostbarste Gut, das Vertrauen des Volkes, zu retten. Das Parlament, in seiner Mehrheit zu ungebildet, als daß es die Vorgänge begriffen hätte, zum Teil auch vom Schmutz der Spekulation infiziert, schwieg.
Was war in der Reihe der großen Bankpaläste noch intakt geblieben? Vor allem die Boden-Creditanstalt, ein Institut, altangesehen, von seinem ehemaligen Leiter, dem Ritter von Taussig, her noch in gutem Ruf. Die „Boden“ hatte sich der herrschenden Partei dadurch verpflichtet, daß sie faule Provinzbanken, Gründungen politischer Geschäftemacher vor dem Untergang rettete. Sie übernahm sich dabei, schluckte mehr, als sie vertragen konnte. Und eines Tags läutete auch ihr das Sterbeglöcklein. Es war jener böse Sonntag, an dem auf Herrn Schobers Befehl die Gendarmen den Baron Louis Rothschild in seinem Jagdrevier aufstöbern mußten. Der Präsident der Credit-Anstalt und Chef des Welthauses sollte Österreich vor der Katastrophe bewahren. Den betrogenen Aktionären der Boden-Creditanstalt wurde damals – Wien hat in solchen Tagen einen bittern Galgenhumor – ein Witz in den Mund gelegt: „Für 50 000 Lombardaktien bekam ich 5000 Unionbankaktien. Für 5000 Union 500 Depositenbank. Für die 500 Depositen 50 Aktien der Boden. Für die 50 Boden bekomme ich 1 Creditanstalts-Aktie. Was werd ich dafür bekommen? Eine Freikarte zu den Komikern!“
Das war vorausschauender Witz. In Wahrheit wagte damals kein Mensch an der Solidität der Credit-Anstalt zu zweifeln. Die Credit-Anstalt!!!! Rothschild!!!! Das nicht zu zertretende Vertrauen des Sparers lebte noch einmal auf wie das glimmende Kohlenstück im Aschenhaufen. In Wien erzählte man sich rührende Märchen vom braven Onkel Rothschild, der so nett gewesen, Österreich zu retten; von seinem genialen Direktor Ehrenfest, der „die Sache schon machen“ werde. Tatsächlich jedoch war die Credit-Anstalt schon damals ein fauler Zauber hinter Marmorwänden.
Als sie am 13. Mai dieses Jahres die Hilfe des Staates anrufen mußte, sagte Herr Neurath, der Oberdirektor, er sei „ganz konsterniert“, er habe „das nie für möglich gehalten“. Es ist schwer auszusprechen, was man von diesen „Wirtschaftsführern“ eigentlich halten soll. Um den Baron Louis Rothschild, feudales Dekorationsstück und Animierplakat, saß eine ganze Reihe von Männern, die von der ergebenen Presse nie anders als „Zierden und Prominenten des österreichischen Wirtschaftslebens“ angesprochen wurden, die Herren Neurath, Lechner, Regendanz, Hammerschlag, Deutsch, Lazar Weiß, Pollak, Langstein. Jeder von ihnen bezog ein Vermögen als Jahresgehalt, daneben Tantiemen und Extragaben als Verwaltungsrat der unterschiedlichsten Unternehmungen. Direktor Neurath trug im Jahr die nette Summe von 526 000 Schilling weg, Direktor Hammerschlag 350 000, Direktor Otto Deutsch 303 000 Schilling. Von der Amstel-Bank, der vielgenannten Gründung der Credit-Anstalt, bezogen die Direktoren Neurath, Regendanz und Ehrenfest Gründeranteile von je 100 000 Schilling. Diese Gründeranteile haben die Herren Direktoren noch im April 1931 behoben, ein paar Tage vor dem Krach! Die Amstel-Bank, als Zentrale für die Fluchtgelder der Creditanstalts-Kommitenten gedacht, ist völlig ausgeplündert worden. Sie war die Bank vieler deutscher und österreichischer Künstler sowie zahlreicher Aristokraten, die ihr Geld vor dem Zugriff der Steuerämter sicher wähnten. Fritzi Massary und Pallenberg allein verlieren in dieser Bank 1 Million Mark. Die Direktoren der Credit-Anstalt, die mit dem Gelde ihres Instituts und dessen Tochteranstalt spekulierten, hatten bei der Amstel-Bank nicht einen Pfennig liegen. Sie kassierten Gewinne ein, deponierten sie aber woanders. Dagegen hat die Amstel-Bank eine Haftung für die Creditanstalt im Betrage von 80 Millionen übernommen und noch in den letzten Tagen, unmittelbar vor dem Krach, 15 Millionen an Personen ausgezahlt, deren Namen verschwiegen werden. Den Herren Direktoren, wohl wissend, warum, war die Bank nicht sicher genug; für das Geld der Credit-Anstalt schien sie ihnen genug sicher.
Die Untersuchung des Status der Credit-Anstalt durch die Sachverständigen hat haarsträubende Tatsachen zutage gefördert. Die Regierung traut sich nicht, den Bericht der Sachverständigen bekanntzugeben. Es ist eine ganze Kette fauler Unternehmungen, die von den Direktoren der Credit-Anstalt finanziert wurden. An einer Zuckerfabrik in Rumänien verliert die Anstalt 50 Millionen; an Petroleum-Beteiligungen in Polen 60 Millionen; an Textilfabriken in der Tschechoslowakei 70 Millionen. Diese ausländischen Geschäfte wurden nur wegen der Tantiemen der Direktoren gemacht. An Tantiemen bezog Neurath allein 300 000 Schilling, Otto Deutsch 150 000, Hammerschlag 180 000 pro Jahr.
Die hohe Bezahlung leitender Männer gäbe keinen Anlaß zu Kritik, sofern die Erträgnisse der geleiteten Unternehmungen den Gagen der leitenden Herren entspräche. Unter den Direktoren der Anstalt war jedoch nicht ein einziger, der befähigt gewesen wäre, das Industriegeschäft der Bank auf eine solide Basis zu stellen. Die „Begabungen“ waren Spekulationsbegabungen, die Gewinne ausschließlich Spekulationsgewinne. Als die Zeit der Spekulation vorbei war, fraß das Defizit aus den verfehlten Beteiligungen die Gewinne, die Reserven und den größten Teil der Einlagen auf.
Gäbe es auf deutschem Boden jene Energie zur Wiedergewinnung des Vertrauens, wie sie Mussolini entfaltet hat, dann müßten alle Direktoren der Credit-Anstalt, als die Urheber des größten Verbrechens an der bürgerlichen Wirtschaftsordnung, auf die Anklagebank. Unter dem Druck der empörten Öffentlichkeit und aufgescheucht von den Zornrufen der Bauernschaft, hat die Regierung sich nach langem Hin und Her entschlossen, nach dem Direktor Fritz Ehrenfest zu „fahnden“. Der Mann ist, weiß Gott, schuldig, und zwar nicht nur die 5 Millionen Schilling, die er mit dem Gelde der Credit-Anstalt und der Amstel-Bank auf eigenem Konto verloren hat. Der weit größere Schaden besteht in Spekulationsverlusten auf Konto der Bank.
Herr Ehrenfest, in Ehren flau, in Keckheit fest, hat aus Paris herübergerufen, man möge ihn nicht reizen, er könne erzählen, wobei „jeder auf seine Rechnung kommen werde“. Er droht. Und zweifellos hätte er viel zu erzählen. Als unumschränkter Herr der Spekulationsabteilung gebot er über den Reptilienfond der Credit-Anstalt. Er weiß zweifelsohne von jedem Politiker, der insgeheim in der Renngasse Subsidien empfing, er kennt das große Register der Schmiergelder, mit welchen die Credit-Anstalt Freundschaften belohnt und Feindschaften zum Schweigen gebracht hat. Skrupellos, schamlos, nur von der Überzeugung geleitet, daß man mit Geld alles machen könne, hat er zuletzt nach Geld gejagt, wo es am leichtesten zu haben war. Er hat sich und die Bank in amerikanischen Effektenkäufen engagiert, die Riesensummen umfaßten. Der Krach in Amerika vernichtete alle Erwartungen. Nach der schweren Niederlage auf dem Felde der Spekulation mußte Ehrenfest vor einem Jahre Wien verlassen. Louis Rothschild war nobel (allerdings auf Kosten der Bank). Er gab Ehrenfest eine stattliche Rente.
Auch das gehört zu der Tragikomödie dieses Zusammenbruchs: Nachdem die Herren die Bank ruiniert hatten und dem Bettler von Staat die verteufelte Aufgabe zuschoben, die Millionenverpflichtungen zu übernehmen, meinten sie, nun sei alles wieder gut. Sie blieben in ihren fürstlichen Zimmern sitzen, in der Erwartung, nach wie vor an jedem Ersten des Monats das üppige Gehalt zu empfangen. Als die Regierung schüchtern zu Sparsamkeit mahnte, strichen sie die Gagen der Beamten zusammen. Die Beamten sahen ein, daß man sparen müsse, sie knüpften jedoch ihre Bereitwilligkeit zur Kürzung der eigenen Einkünfte an die Forderung, daß man auch die Gehälter der Direktoren kürze. Da hätte man die Direktoren sehen sollen! Die Unverschämtheit dieses Mißverstehens ließ schließlich das Parlament aufhorchen. Es währte aber noch lange, bis man die Koalition von Raubgier, Unwissenheit und Schamlosigkeit aus dem Hause bekam. Man mußte die Herren Direktoren vom Hausverwalter hinaustreiben lassen; so schwer fiel es ihnen, die Stätte ihrer Plünderungen zu verlassen.
Vom Staatsanwalt blieben sie verschont. Nur Fritz Ehrenfest wird „kurrendiert“. Während aber die Justizverwaltung ein Strafgericht verspricht, schwimmt Fritz Ehrenfest, mit Reisegeld reichlich ausgestattet, nach Amerika. Er hat verkündet, jeden Tag bereit zu sein, sich der österreichischen Justiz zu stellen. Die Justiz schwieg. Da die unabhängige Presse seine Verhaftung forderte, begann er zu drohen. Darauf kam ein Fangspiel zwischen der Polizei und der Justiz, wer von den zweien gegen Ehrenfest einschreiten solle. Endlich erschien das „Fahndungsblatt“. Zur selben Stunde dampfte Ehrenfest ab.
Böse Zungen behaupten, daß das Reisegeld in einem amtlichen Kuvert war. Und dazu erzählt man eine Geschichte vom alten Taussig, dem ehemaligen Gouverneur der Boden-Creditanstalt: Während einer Verwaltungsratssitzung berichtet der Sekretär von dem Brief eines Erpressers, der mit der Veröffentlichung gewisser Bilanzgeheimnisse droht für den Fall, daß man ihm nicht willig sei. Ein Verwaltungsrat springt auf und fordert, den Mann mit den Geheimnissen vor Gericht zu zitieren. Darauf der alte Taussig: „Schicken Sie ihm das Geld; ich bin nicht neugierig!“
Auch die österreichische Regierung ist nicht neugierig. Sie weiß!
[Süddeutsche Sonntagspost, Jg. 5, Nr. 45, 8.11.1931, S. 8‑10 (Franz Hals).]
Abschied von edlen Pferden
Die Spanische Hofreitschule ist auch bedroht
Die Ritterszeit hat aufgehört
Und hungern muß das stolze Pferd.
Das dumme Luder, der Esel aber
Bekommt noch immer sein Heu und Haber.Heinrich Heine
Sonntag war es das letzte Mal, daß die edlen Rösser der Wiener Spanischen Hofreitschule ihre hohe Kunst zeigten. Werden diese Vorführungen im nächsten Jahr eine Fortsetzung finden? Man weiß es noch nicht. Es gibt eine banausische Opposition gegen diesen Rest einer niemals wiederkehrenden Schönheit, die mit plumper Demagogie darauf hinweist, daß „in dieser Zeit“ Pferde keine staatliche Fürsorge genießen dürfen. Die Spanische Hofreitschule kostet den österreichischen Staat fast gar nichts. Die Stallungen des Hofes sind da, die Rösser und ihre Bereiter erhalten sich fast ganz aus den Einnahmen der allsonntäglich wiederkehrenden Produktionen. Die Spanische Hofreitschule hat ihr Publikum. Während der Fremdensaison überwiegen Engländer und Amerikaner, die den Seltenheitswert dieser höfischen Einrichtung zu schätzen wissen; sie finden Gleiches auf der ganzen Welt nicht wieder. Auch in Wien aber gibt es treue Stammgäste der herrlichen „Lipizzaner“, und es ist interessant, daß zu diesen Gästen viele kleine Leute, auch Arbeiter, gehören. Es ist nämlich gar nicht wahr, daß das Volk solche Schauspiele nicht wolle und nicht brauche. Gerade die unverdorbenen Schichten des einfachen, naiven Volkes haben eine natürliche Freude an schönen Dingen. Die Tausende, die Sonntag nach Schönbrunn pilgern, genießen die Pracht des Schlosses und der Parkanlagen; die Besucher der Hofburg und der Stallungen erfreuen sich an dem Pathos der großartigen Architektur.
Es ist zu loben, daß die verarmte österreichische Republik diesen einen Luxus aus der großen Zeit der Habsburger sich, wenn auch in beschränktem Ausmaße, erhalten hat. Die Spanische Reitschule selbst ist eine Sehenswürdigkeit; sie ist fast unverändert, wie sie Karl VI. nach den Plänen Fischer von Erlachs errichtet hat. Die Pferde aus dem Gestüt Piber in Steiermark werden vierjährig in die Spanische Schule gegeben. Hier müssen sie etwa drei Monate an der Longe arbeiten und werden, nach und nach, schonend angeritten. Die „Lipizzaner“ – ausschließlich Hengste – bedürfen einer langen Lehrzeit; je zarter man sie behandelt, ein umso höheres Alter erreichen sie. Die intensivere Arbeit beginnt erst im zweiten Jahr. Es ist ein weiter Weg, ähnlich nur der schweren Schule der Balletteusen. Zuerst kommt das Piaffieren an der Hand, dann, je nach dem Talent des Pferdes, die Arbeit an den Pilaren. Der vierbeinige Schüler steht zwischen den zwei Pflöcken und lernt hier den spanischen Tritt, die Levaden, Courbetten, Kapriolen. Diese hohe Schule hat nichts zu tun mit Dressurakten des Zirkus; sie fußt auf der vollkommenen Kenntnis des Pferdes und seiner natürlichen Veranlagung. Sie ist seit dem sechzehnten Jahrhundert unverändert geblieben bis auf den heutigen Tag. Allerdings: sie hat außer der Wiener Spanischen Schule keine Stätte mehr. Die Oberbereiter Zrust, Lindenbauer und Pollak sind die letzten Meister dieser großen Überlieferung.
Es ist ein wunderbarer Anblick, die schlanken Reiter in der spanischen Tracht – Dreispitz, brauner Frack, weiße Lederhose, hohe Reitstiefel – auf den weißen Rössern zu sehen. Die Lipizzaner-Hengste sind heroische Pferde, den uns bekannten Nutztieren unähnlich. So wie sie haben die Rassepferde des sechzehnten, siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts ausgesehen; wir kennen sie nur von den Denkmälern der Barockzeit, von den Bildern Rubens’ und van Dycks, Velazquez’ und Goyas. Hier sind diese barocken Wesen leibhaftig vor uns mit ihren üppigen Formen, den kühn geschwungenen Hälsen, schnaubenden Nüstern und zarten Gelenken. Sie gehören in die Barockarchitektur Fischer von Erlachs, und zu ihnen gehören die alten Jagdfanfaren aus dem sechzehnten Jahrhundert, die schmetternden Märsche der Dampierre-Kürassiere, die Polonaisen des Rokokos. Auch die Namen der Pferde haben den Klang prachtliebender Zeiten: Conversano Bonavista, Neapolitano Bienda, Maestose Alba, Pluto Sylvana. Ein Waldhorn-Quintett und Trompeter der Staatsoper blasen die Fanfaren, Märsche und Polonaisen.
Unser Zeitalter ist edlem Mäzenatentum nicht günstig. Was die Welt an Schönheit empfangen hat, war von großen Kirchenfürsten und aristokratischen Höfen gegeben. Die Mäzene von heute – was protegieren sie eigentlich? Wofür haben sie Sinn? Die Staaten sind zu arm geworden, als daß man von ihnen auch die Sorge um das Schöne verlangen dürfte. Die Nützlichkeitsfanatiker sollten aber auch nicht unbedingt recht haben. Die letzten paar Edelpferde der Welt, die heute noch in der Wiener Spanischen Reitschule versammelt sind, bereiten mehr Freude als der unnütze Ballast so vieler Schwätzer, die auf Staatskosten die Menschheit langweilen.
[Süddeutsche Sonntagspost, Jg. 5, Nr. 50, 13.12.1931, S. 26 (Franz Hals).]
Der Putsch vom 13. September auf der Anklagebank
Bilder vom Grazer Hochverratsprozeß
Man stellt sich Österreich gewöhnlich als ein sehr gemütliches Land vor, in dem auch Staats- und Hauptaktionen gemütlich erledigt werden. Die Landschaft, die Menschen, ihre Sprache vertragen nicht, daß man auf Stelzen geht. Wie im Bayerischen herrscht auch hier eine Abneigung gegen das „Hochdeutsche“. In der heimatlichen Mundart kann man wohl grob, aber niemals pathetisch werden; „g’schwollen“ sagt man in solchem Fall.
Das „Gemütliche“ darf aber nicht darüber täuschen, daß der kleine Staat sich zu wehren weiß und, wenn es ihm an die Gurgel geht, keinen Spaß versteht. Die Leser der „Süddeutschen Sonntagspost“ erinnern sich des Putsches vom 13. September. Der Führer der steiermärkischen Heimwehren, der Judenburger Rechtsanwalt Dr. Walter Pfrimer, meinte damals, es sei der richtige Augenblick gekommen, die rechtmäßige Regierung zu stürzen und sich selber an deren Stelle zu setzen. Auch er hatte ein falsches Bild von Österreich. Er meinte, die Mehrzahl im Lande sei der parlamentarischen Herrschaft überdrüssig, und er war überzeugt, daß man ihn und seine Truppen nach einem siegreichen Zug auf Wien als Erlöser preisen werde. Auch mit der Zustimmung der Landesbehörden, der Gendarmerie und eines Teils des Bundesheeres rechnete er. Er rechnete falsch. Das anscheinend so gemütliche Österreich verstand plötzlich keinen Spaß; es marschierte die Gendarmerie auf, das Bundesheer entwaffnete die zivilen Truppen, und in wenigen Stunden war der Putsch erledigt. Herr Dr. Pfrimer floh über die Grenze, nach Jugoslawien, nach München und Ulm, von wo er dann die Heimreise antrat und sich dem Grazer Gericht stellte.
Man hat den österreichischen Gerichten den Vorwurf gemacht, daß sie den Anschlag auf den Staat allzu gemütlich hinnähmen; die verhafteten Führer und Teilnehmer an dem Putsch wurden nach wenigen Tagen wieder freigelassen. Die österreichische Justiz behielt ihr gemütliches Gesicht, aber sie arbeitete im stillen. Es wurden nicht weniger als 4231 Personen einvernommen, davon 280 in Voruntersuchung gezogen. Die Verbrechen, deren die Verdächtigen bezichtigt werden, sind schwer; Teilnahme und Mithilfe am „Hochverrat“ werden mit langen Kerkerstrafen bedroht. Im alten Strafgesetz verfiel der Hochverräter dem Tode. Als nach dem Umsturz die Todesstrafe in der Republik Österreich abgeschafft wurde, trat an ihre Stelle zwanzigjährige Kerkerhaft für den unmittelbaren Täter, zehn bis zwanzig Jahre Kerker für Mitschuldige.
Von den vielen Beschuldigten wurden zunächst sieben angeklagt. Es sind neben Dr. Pfrimer, der im letzten Moment sich stellte, drei ehemalige Offiziere der k. u. k. Armee, die Oberste a. D. Flechner und Hofer, und der Oberstleutnant a. D. Riedlechner, ferner ein Forstrat aus Bad Aussee namens Harter und der Weinhändler Kammerhofer aus St. Marein im Mürztal. Wer die sieben auf der Anklagebank gesehen, der wird schwerlich den Eindruck von Verschwörern haben. Es sind durchwegs biedere Männer, die gemeint hatten, dem Vaterland einen großen Dienst zu erweisen. An Dr. Pfrimer ist die freiwillige Verbannung nicht spurlos vorübergegangen. Er ist gealtert, seine Züge sind härter geworden. Er ist ein guter Redner, und er ist sichtlich bemüht, in guter Haltung durch diesen Prozeß zu kommen. Wer vorurteilslos seine Verteidigung hört, der kommt zu der Erkenntnis, daß allen diesen Träumern von der gewaltsamen Ergreifung der staatlichen Macht das große Vorbild Mussolini den Kopf verdreht hat. Mussolini ist, ohne daß er dafürkönnte, der Nährvater aller geträumten und versuchten Putsche auf deutschem Boden. Was dem einen gelang, so meint man’s, müßte auch den andern gelingen. Auch die österreichischen Heimwehren sind militärisch organisiert, sie haben ihre Landesverbände, ihre Kreise, eine militärische Führung, die zumeist in Händen ehemaliger Offiziere liegt. Ursprünglich war die ganze Bewegung als Abwehr gegen Umsturzpläne von links gedacht, später jedoch bemühten sich verschiedene Personen, der rasch emporgewachsenen Organisation auch einen positiven Inhalt zu geben. Einer der ersten, der die neue Bewegung auf die Bahnen des Gesetzes zu lenken trachtete, war der ehemalige Bundeskanzler Dr. Seipel. Dieser klarsehende Politiker erkannte, daß man eine bewaffnete Macht, wie sie hier entstand, nicht sich selber überlassen dürfte; er wollte das Gute erhalten, das Revolutionäre der Bewegung möglichst ausschalten. Seine Bestrebungen scheiterten an den Gegensätzen innerhalb der Heimwehren. Die einzelnen Landesverbände stimmen nämlich keineswegs miteinander überein. Die Heimwehr Oberösterreichs, soweit sie dem Fürsten Starhemberg untersteht, will keine großdeutsche Politik; die Steiermärker sind national und suchen Anlehnung an den Nationalsozialismus. Daneben aber gibt es noch Organisationen, die der alten Christlichsozialen Partei zugehören.
Die Einigkeit der verschiedenen Gruppen besteht nur in der Abneigung gegen den Parlamentarismus. Der Zukunftsstaat soll nicht von Gewählten des allgemeinen Wahlrechts regiert werden. Man will an deren Stelle einen Diktator und ihm zur Seite eine Ständevertretung haben. Auch an diesen Details ist das Vorbild Mussolinis zu erkennen. Die Anwälte dieser Ideen haben jedoch verkannt, daß die alten Parteien in dem Volke und in der Verwaltung Österreichs sehr fest verwurzelt sind. Herr Dr. Pfrimer hat sich die Machtergreifung sehr leicht vorgestellt, als er glaubte, es genüge, ein paar Bezirkshauptleute ihres Amtes zu entsetzen und im übrigen alles auf den „Marsch gegen Wien“ ankommen zu lassen. Der Major Pabst, dieser gelernte Soldat, hatte schon recht, als er neulich sagte, daß der Putsch Pfrimers „kindlicher Dilettantismus“ gewesen sei. Dr. Pfrimer hat die Sache jetzt so dargestellt, als ob er den Erfolg seines Unternehmens vom Enthusiasmus des Volkes hätte abhängig machen wollen. Das erinnert einigermaßen an die berühmte „Militärmusik“, mit der Andrássy 1878 Bosnien und die Herzegowina erobern wollte. Aus der Militärmusik wurden nachher sechs Korps, ein Drittel der gesamten Wehrmacht des österreichisch-ungarischen Kaiserstaates. Mit der Militärmusik ist kein Land zu erobern, mit Fahnen und Hochrufen kein Putsch zu gewinnen.
Die Geschworenen, die über Schuld und Sühne zu entscheiden haben, kleine Landwirte aus der Grazer Umgebung, Kaufleute aus der Stadt, Privatbeamte, ein Baupolier und ein Zimmermann, lächelten, als Dr. Pfrimer die Unzulänglichkeit seiner strategischen Absichten und der taktischen Anordnungen darlegte. Gewiß, wenn es nicht auch Tote und Verwundete gegeben hätte, könnte man sagen, der Putsch sei recht harmlos gewesen. Diese kleinen Leute nehmen aber doch auch ihr Amt sehr ernst; sie müssen das Gesetz anwenden. So gemütlich es klingt, wenn die Verteidigung darauf hinweist, daß der ganze Putsch im Grunde doch so ungefährlich gewesen sei, so wird darum die Absicht nicht ausgetilgt. „Meine Herren Geschworenen, ich wollte zwar die Macht im Staate, ich wollte auch die Minister Winkler, Vaugoin und den Landeshauptmann Schlegel festnehmen lassen, aber schaun S’ mi an, ich hätt’s ja gar nicht zustand gebracht.“
Die Untauglichkeit der Personen und Mittel als Milderungsgrund. Ein Geschworener sagte nicht unzutreffend: „Wann’s gelungen wär’, tät’ er jetzt anders reden.“
Man darf die österreichische „Gemütlichkeit“ nicht falsch einschätzen. Hinter der gänzlich unpathetischen Form des Landes regieren sehr feste Leute mit oberösterreichischen Bauernschädeln. Sie haben es, weiß Gott, nicht leicht; die Credit-Anstalt hätte ein stärkeres Land umgebracht, als es Österreich ist. Dazu der übrige Jammer, Arbeitslosigkeit, Währungssorgen, Defizit im Staatsbudget – es gehören gute Nerven, Bauernnerven dazu, den Kopf oben zu behalten. Der Putsch vom 13. September war eine Extradraufgabe; Österreich hat die Sache auf ganz anständige Art erledigt.
[Süddeutsche Sonntagspost, Jg. 5, Nr. 51, 20.12.1931, S. 9‑10 (Franz Hals).]
Fünf Bettler suchen ein Dach!
Was sie zerrissen, suchen sie vergebens nun zu flicken – Ist ein Zusammenschluß der Donauländer möglich?
„Man wird das alte Österreich einmal auszugraben suchen, es wird sich aber zeigen, daß man Zerrissenes nicht flicken kann.“ Diese Worte sprach der letzte kluge Kopf Franz Josephs, Freiherr von Beck, nach den Friedensschlüssen von Versailles und St. Germain. Es klang wie eine Grabrede, die Vergangenem nachweint. Vor uns lag ein neues Mitteleuropa, erfüllt von dem Jubel der siegreichen Nutznießer. Fünfzehn Jahre danach sieht man, daß die neue Ordnung nicht leben kann …
Keine der großen Friedenskonferenzen der Weltgeschichte hat ein so untaugliches Werk geschaffen wie jene von 1918. Von den Urhebern der neuen Ordnung, Franzosen, Engländern und Amerikanern, kannte keiner Mitteleuropa. Die Kenntnis der politischen Geschichte genügte nicht, die Bedeutung des österreichisch-ungarischen Wirtschaftsgebiets zu erfassen. Dieses sechshundert Jahre alte Gebilde war nicht nur eine durch Eroberung und Heiraten zusammengefügte Hausmacht, es war ein Raum, in dem sich Industrie und Landwirtschaft wundervoll ergänzten. Alles war nach dem natürlichen Bedürfnis gewachsen, die Industrien Böhmens, Mährens und Schlesiens versorgten ein Fünfundvierzigmillionen-Reich; die Agrarprodukte Ungarns und der Alpenländer strömten in die Städte. Der Ausgleich vollzog sich ohne Plan, aber auf natürliche Art planvoll. Das gewaltsame Zerreißen aller Fäden, die die Geschichte gesponnen, hat auf einem durch den Krieg verarmten Boden neue Industrien erstehen lassen, ohne daß sich neue Märkte erschlossen hätten. Die alten Industrien waren spezialisiert, auf eine bestimmte Kundschaft eingestellt. Die Wirkereien in Böhmen und Mähren erzeugten Tücher und Stoffe für die Bauern und Bäuerinnen Ungarns und der Slowakei; die Reichenberger und die Brünner Tuche kamen nach Wien, wo ein differenziert ausgebildeter Handel jedes Land des weiteren Reiches nach dessen Geschmack bediente. Ein ganzer Stadtteil in Wien, das Viertel des Franz-Josephs-Kais, gehörte der Textilindustrie. Die hochentwickelten Brauereien Böhmens versandten ihre Biere ohne Zwischenzoll auf einem Gebiet, das von Bodenbach nach Triest, von Czernowitz bis zum Bodensee reichte. Die fetten Mastochsen Ungarns, seine Weine und Früchte wanderten nach der Reichshauptstadt. Wittkowitz, die Eisenstadt, ruhte auf dem Postament des großen Reichs, Skoda, das Waffenwerk bei Pilsen, und Steyr, die oberösterreichische Industriezentrale, versorgten eine der stärksten Armeen.
Heute liegt alles brach. Wittkowitz ist für die Tschechoslowakei zu groß, Steyr längst auf ein Minimum reduziert, und auch Skoda feiert. Die große wirtschaftliche Einheit hat man parzelliert, aus den Großindustriellen sind sozusagen Parzellenfabrikanten geworden. Zwischen den neuen Grenzen türmen sich Zollwälle. Es ist, als ob man einen Körper in seine Teile zerschnitten hätte; nun liegen Arme, Beine, Rumpf nebeneinander.
Der Gedanke, die Donauländer Tschechoslowakei, Österreich, Ungarn, Jugoslawien und Rumänien einander wieder näher zu bringen, ist viel leichter gedacht als getan. Während der fünfzehn Jahre der Selbständigkeit hat sich vieles geändert. Österreich hatte nach dem Umsturz weder Brotgetreide noch Zucker, noch Milch; von den Nachfolgestaaten im Stiche gelassen, litt es 1918 bitterste Not. Seither sind bedeutende Kapitalien in der Landwirtschaft, in agrarischen Industrien, in den Bergbau und zum Ausbau der Wasserkräfte angelegt worden. Heute deckt Österreich einen namhaften Teil seines Bedarfs an Brotgetreide aus der eigenen Produktion, es beliefert die Brauereien mit eigener Gerste, und es ist auch in Zucker, Milch und Milchprodukten nicht mehr auf die Einfuhr angewiesen. Auch in der Viehzucht hat Österreich bedeutende Fortschritte gemacht; der Rinderauftrieb auf dem Schlachtviehmarkt Wien stammt zu neunzig Prozent aus dem Inland. Unter den fünf Donaustaaten sind drei reine Agrarstaaten, die für den Überschuß ihrer landwirtschaftlichen Produkte Absatz suchen. Österreich würde bei der Aufhebung des Schutzzolls seine mit schweren Opfern aufgerichtete Agrarwirtschaft gefährden. Es hat deshalb verlangt, daß innerhalb einer neuen Ordnung sein eigener Absatz und die Preise gesichert werden müßten. Wenn aber die anderen Staaten ihre Produkte nicht billiger absetzen könnten als der inländische Produzent, dann wäre der Wettbewerb ausgeschlossen und Präferenzzölle hätten einen zweifelhaften Wert.
Das ist eine der Veränderungen, die sich innerhalb der fünfzehn Jahre vollzogen haben. Solcher Gegensätze, die der Wiederaufrichtung des alten Wirtschaftsraums entgegenstehen, gibt es aber viele. Wer die gegenwärtige Situation Zentraleuropas kennt, der muß zu der Überzeugung kommen, daß dieser zerstörte Boden für eine großzügige Rettungsaktion zu eng geworden ist. Es gibt eben kein altes Österreich mehr, und es gibt nicht die alten Ergänzungsmöglichkeiten innerhalb des Donauraums. Was man darüber spricht, ist Poesie, nicht Wirklichkeit; politischer Wunschtraum, nicht wirtschaftliche Wahrheit. Die Anwälte der wirtschaftlichen Donauföderation appellieren denn auch merkwürdigerweise an alte Gefühle und Stimmungen, sie erinnern daran, daß die Völker, die die Landschaften der Donau bewohnen, durch die Geographie, die Küche, das Klima verwandt seien. Im alten Habsburgerreich appellierte man an die gemeinsam erlebte Geschichte, an die Tradition, an die lebende Wirklichkeit einer blühenden Wirtschaft. Leider vergaß man die nationale Frage innerhalb des gemeinsamen Rahmens zu lösen. Jetzt haben die kleinen Nationen ihre nationale Selbständigkeit, aber um den Preis, daß die blühende Wirtschaft dabei flötengegangen ist. Als es den Verwandten unter einem Dach gutging, wollten sie beieinander nicht bleiben; jetzt, wo sie Bettler geworden, suchen sie wieder ein gemeinsames Dach …
Tardieus Plan wird von zwei Motiven gespeist: Frankreich will die Kredite, die es den Staaten der Kleinen Entente gegeben hat, nicht verlieren. Das ist das wirtschaftliche Motiv des Plans. Es will aber zugleich Deutschland und Italien von der mitteleuropäischen Kombination fernhalten. Das ist das politische Motiv. Das stärkste Argument gegen diese Absichten spricht die Wirtschaftsstatistik. Von der gesamten Einfuhr der fünf Donauländer fallen 24 Prozent auf Deutschland, 5 Prozent auf Italien; von der Gesamtausfuhr der fünf Länder nimmt Deutschland 15 Prozent, Italien 10 Prozent auf. Den Donauländern untereinander gehören zwei Fünftel ihres Gesamthandels. Es ist unmöglich, daß die Tschechoslowakei und Österreich den Überschuß der drei reinen Agrarstaaten, Ungarn, Jugoslawien und Rumänien, unterbringen. Andererseits zeigt die starke Einfuhr Deutschlands und Italiens, daß die beiden Länder mit dem Donauraum wirtschaftlich verknüpft sind. Die Wiederherstellung der mitteleuropäischen Wirtschaft kann also nur auf der größern Basis erfolgen, die die beiden ergiebigen Märkte, den deutschen und den italienischen, einschließt.
Es nützt nichts, sich dagegen zu sträuben, daß die Not Mitteleuropas nur als Ganzes aufgefaßt und behandelt werden kann. Mögen die Apostel der Abschließung und der politischen Teillösung ihre ganze Macht in die Waagschale der Entscheidung werfen: sie werden das Elend vergrößern, nicht lindern. Der Plan zur Donauföderation kann nur eine Etappe auf dem Weg zum gesamten Mitteleuropa sein, dem auch Deutschland und Italien angehören.
[Süddeutsche Sonntagspost, Jg. 6, Nr. 16, 17.4.1932, S. 10‑11 (Franz Hals).]
Der Glaube an den Krieg
Wer will den Krieg? Wer besingt den Krieg? Wer erzieht die Jugend zu kriegerischem Denken? Wer preist den Tod auf dem Schlachtfeld als das einzige erstrebenswerte Ziel des Menschen?
Man könnte diese Fragen vermehren; sie alle weisen auf eine Macht als den bewußten Träger kriegerischen Willens. Jede der großen Nationen Europas hat ihre kriegerische Tradition, aber nur in einer einzigen hat sich der Glaube erhalten, daß der Krieg auch heute noch ein geeignetes Mittel sei, die Macht und das Ansehen des Staates zu heben. Die Antwort auf die Frage, warum die Glorifizierung des Krieges eine ausschließlich preußisch-deutsche Angelegenheit geworden ist, gibt die Geschichte. Preußen ist durch glücklich geführte Kriege groß geworden. Der Geburtstag jenes unerschütterbaren Glaubens an den Krieg als an das einzige Mittel zur Erhöhung der Macht ist jener Tag, da sich Friedrich II. entschloß, unbekümmert um Verträge und gegebene Versprechungen, mit dem vom Vater geerbten vorzüglichen Kriegsinstrument über Österreich herzufallen und ihm Schlesien zu entreißen. Von da an datiert Preußens Aufstieg vom wenig geachteten Kleinstaat zum Range einer europäischen Macht; von da an beginnt der preußische Enthusiasmus für den Krieg, dem sich selbst der junge Goethe nicht entziehen konnte. („Wir alle waren damals fritzisch gesinnt.“) Napoleon hat zwar das preußische Heer an einem Tag vernichtet, aber der Glaube an die Zweckmäßigkeit des Krieges blieb von der Niederlage unberührt. Im Gegenteil: erst auf den Schlachtfeldern der napoleonischen Kriege wuchs jene preußische Lehre vom „absoluten Krieg“ empor, die in der Bibel aller Militaristen, in Clausewitzens Buch „Vom Kriege“ ihren klassischen Ausdruck gefunden hat.
Die beiden siegreichen Kriege Preußens, von 1866 und von 1870/71, haben den Enthusiasten der Vernichtung recht gegeben. Es war der große Fehler des modernen Pazifismus, ausschließlich an die humanen Elemente im Menschen zu appellieren und den Krieg an sich als Teufelswerk zu verfluchen. Wie wollte man die unter Preußens Führung großgewordene Nation überzeugen? Hätte Preußen seine Vorherrschaft in Deutschland etwa mit Mitteln zivilisatorischer Beglückung erreicht? Noch in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts hatte Clausewitz wirklich recht; der Krieg war, gut geführt, tatsächlich „die Fortsetzung der Politik mit andern Mitteln“. Die große historische Entscheidung, ob das alte Kaiserhaus Habsburg ein Recht habe, Deutschlands Schicksal mitzubestimmen – nebenbei: die folgenschwerste Entscheidung, unter der wir und ganz Europa heute leiden –, war in sechs Stunden erledigt. Die Schlacht bei Königgrätz währte von 8 Uhr morgens bis 2 Uhr nachmittags. Der Preis: 9.172 tote oder blessierte Preußen und, entsprechend der dreimal so großen Feuerwirkung des preußischen Gewehrs, dreimal so viel tote oder verwundete Österreicher: 31.424. Angesichts der geringen Opfer und des unermeßlichen Gewinns konnten die Preußen nicht sagen, daß der Krieg kein taugliches Mittel der Politik sei. Auch im Kriege von 1870/71 waren die Opfer im Verhältnis zu den Heeresstärken der Deutschen nicht übermäßig groß; es gehörte zu Moltkes Feldherrnkunst, unnötige Hinschlachtungen zu vermeiden; Offensiven lebendiger Menschenleiber gegen feuerspeiende Berge, wie sie die Taktiker des Weltkriegs unternommen haben, wären unter Moltkes Führung unmöglich gewesen.
Es steht außer Frage, daß der Krieg einmal ein taugliches Mittel war, geschichtliche Entscheidungen zu erzwingen. (Der alte romantische Krieg schmeichelte auch der Einbildung, daß die individuelle Tapferkeit zur Entscheidung beitrage.) Ist der Krieg aber auch heute noch ein taugliches Mittel? Wird man mit der Entfesselung der vielen zu Gebote stehenden Kriegswerkzeuge auch heute noch das angestrebte Ziel erreichen? Dies allein ist die Frage. Und zwar eine Frage, die stündlich aktueller wird. Denn darüber kann es keinen Zweifel mehr geben, daß die allseits mit größter Intensität betriebene Erhöhung aller Rüstungen den Krieg vorbereitet. Es gibt Philosophen, die angesichts dieser Gefahr für den Bestand Europas von einem unabänderlichen Schicksal sprechen; der Krieg sei eine „ewige Kategorie“, die Menschen seien keine Engel, unwandelbar in ihren Trieben usw., usw. In Wirklichkeit liegen die Dinge doch anders. Wer nur halbwegs über den Zustand Europas außerhalb der unglückseligen Mitte unterrichtet ist, der weiß, daß weder in England noch in Frankreich auch nur ein Mensch Sehnsucht hat, seinen Mitmenschen den Bauch aufzuschlitzen. England ist derart pazifistisch, daß es, in dem Glauben an die Möglichkeit eines Ausgleichs, bis zur äußersten Grenze des Entgegenkommens zu gehen sich entschlossen hat. Und was sollte sich Frankreich von einem Kriege erhoffen? Es hat, um es einfach zu sagen, nur eine Sorge: nicht überfallen zu werden.
Die bewußte Pflege kriegerischen Denkens, die systematische Erziehung der ganzen Nation zu Kriegern – das sind ausschließlich deutsche Eigenheiten. Man kann ruhig zugeben, daß diese Entwicklung durch die Bestimmungen des Friedensvertrages und durch eine Politik, die die deutsche Demokratie mit allen Sünden dieses Vertrages belastete, wesentlich gefördert wurde. Es kommt dazu, daß der rebellisch gewordene kleine Mann in Deutschland das Kriegserlebnis als Flucht und Erlösung aus der Misere seiner recht trostlosen Tage empfände. Der Bureaudiener zum Beispiel, der im Kriege Korporal gewesen, wünscht sich weg vom schmalen Lohn, von seiner klagenden gealterten Gattin, vom Einerlei des Berufes. Der kargbesoldete Beamte, von den Wanzenstichen des gewöhnlichen Tages geplagt, sehnt sich, da er die Schrecken des Krieges vergessen, zurück zur Kompagnie, wo er Reserveoffizier gewesen. Der Intellektuelle, ohne Aussicht auf Erwerb, will lieber Soldat als Arbeitsloser sein. Ihre Phantasie eilt von den Unannehmlichkeiten eines traurigen Daseins zum romantisch verklärten Krieg. Sie reicht bei dem unsinnlichsten aller Völker nicht aus, sich die wirkliche Gestalt des Krieges von morgen vorzustellen. Allerdings: auch der genialste Kriegsmann wird heute nicht zu sagen vermögen, wie der kommende Krieg beschaffen sein wird. Da als erste der Waffen das Kriegsluftschiff in Aktion treten und vor allem gegen die Gehirne der Feinde, gegen die Hauptstädte mit dem Sitz der Regierungen und Zentralämter, operieren wird, läßt sich das Bild Europas am ersten Tage des Krieges nur schaudervoll ahnen. Was dann weiter geschehen wird? Ob es zwischen Ruinen und Leichenhaufen eine Kriegsführung geben wird? Ob man noch Schlachten schlagen oder sich auf kürzestem Wege umbringen wird? Wer kann das heute sagen? Vielleicht ist dem einst edel gewesenen Teil der Welt, der Europa heißt, das Schicksal Griechenlands bestimmt. Auch in der antiken Welt ging das Unheil von einem preußisch veranlagten Volke, von den Spartanern, aus, als sie gegen die eigenen Verwandten die Perser heranriefen und jene Kriege einleiteten, die zur endgültigen Vernichtung aller führten. Wenn man Griechenland vor Augen hat, schreibt Hegel in seiner „Philosophie der Geschichte“, so verstehe man, wie die edleren Menschen nur verzweifeln konnten. „Der Partikularität der Leidenschaften, der Zerrissenheit, die Gutes und Böses niederwarf, stand ein blindes Schicksal, eine eiserne Gewalt gegenüber, um den ehrlosen Zustand in seiner Ohnmacht zu offenbaren und jammervoll zu zertrümmern. Heilung, Besserung und Trost waren unmöglich.“
[Wiener Sonn- und Montags-Zeitung, Jg. 73, Nr. 12, 25.3.1935, S. 4 (Karl Tschuppik).]
Ludendorffs Wiederkehr
Ich will, ausnahmsweise einmal, von mir sprechen. Zu einer Zeit, da das deutsche Volk seinen besten Soldaten – so nannte ihn Churchill – als toten Hund behandelte, war ich der einzige unter allen zivilen und militärischen Schriftstellern der deutschen Sprachwelt, der sich des vergessenen Generals Ludendorff annahm. Das deutsche Volk, das sich selber die positiven Eigenschaften des Hundes als Nationaltugenden zuschreibt, hatte auch in diesem Falle gezeigt, daß es weder treu noch anhänglich ist. Die Masse („das Volk“ gibt es nur in Ministerreden und bei den Märchendichtern) ist nicht „treu“; sie ist unterwürfig, wo sie fürchtet, und anhänglich, wenn man ihr schmeichelt – das Gefühl der Dankbarkeit kennt die Masse nicht, weil dieses Gefühl etwas voraussetzt, was die Masse nicht hat, nicht haben kann: die innere Beziehung zu einem Menschen. Die Eliminierung Ludendorffs aus dem Gedächtnis der Lebenden war allerdings ein ganz krasser Fall. Ludendorff war nach Tannenberg und dem Feldzug im Osten zwei Jahre lang, von seiner Ernennung zum „Zweiten Chef“ des Feldheeres, Ende August 1916, bis zu seiner Verabschiedung, 26. Oktober 1918, tatsächlich der Herr und Gebieter des kämpfenden Deutschlands gewesen; mit Willen der oberste Feldherr, wider Willen, nur weil es keinen anderen gab, der Diktator des Deutschen Reiches. Hier lag ein Problem vor, das aufzuhellen umso dringender schien, als sich um die historische Wahrheit ein dichtes Gestrüpp patriotischer Lügen zu breiten begann. Die Ermittlung der Wahrheit war gar nicht so schwer; es lag das große Werk des parlamentarischen Untersuchungsausschusses vor. „Die Ursachen des deutschen Zusammenbruches“, 18 Bände der genauesten Einvernehmungen, Gutachten, Aktenstücke, Zeugenaussagen (die allerdings kein Mensch gelesen hat). Mein Buch, „Ludendorff, die Tragödie des Fachmannes“, ist 1931 erschienen; es fand Anerkennung bei der preußischen Militärwissenschaft. Die Menge verstand es nicht; man kennt den deutschen Einwand gegen unangenehme Wahrheiten: „So jenau woll’n wa det jar nich wissen!“ Die „Frankfurter Zeitung“ schrieb in einem großen Referat: „Ein Buch, das mit seltenem Anstand, mit scharfem Blick für das Wesentliche geschrieben ist; mit dem Freimut dessen, der unparteiisch das Recht, auf das Ludendorff Anspruch hat, sucht; allzu nachsichtig manchmal, nicht aus Vorurteil, sondern im Drang, objektiv zu sein. Die gründliche, geistvolle Schilderung ist der Ansatz zu einer gültigen Wertung …“
Die endgültige Wertung läßt lange auf sich warten. Inzwischen nämlich hatte das deutsche Volk sich an der fetten Lüge delektiert, daß der Generalfeldmarschall Hindenburg der Meister des deutschen Krieges gewesen sei. Ich habe mich in meinem Buch mit dieser Lüge gar nicht weiter abgegeben, weil ich die Kenntnis des Tatsächlichen, wie sie jedem Offizier und dem Kenner der Materie eigen war, als selbstverständlich annahm. Jeder militärisch orientierte Mensch wußte, daß in den Nottagen des Augusts 1914 (genau: am 22. d. M.) nicht Hindenburg, sondern Ludendorff von der Obersten Heeresleitung an die Stelle der großen Gefahr gerufen worden war. „Ich weiß keinen anderen Mann, zu dem ich so unbedingtes Vertrauen hätte, als wie zu Ihnen …“, schrieb ihm Moltke. Und der General von Stein, der Generalquartiermeister, telegraphierte: „Sie müssen hin. Hier fordert es die Staatsraison!“ Hindenburg? Den ehemaligen Kommandeur des Magdeburger Korps, der als Pensionist in Hannover saß, hatte man hervorgeholt, weil er dem Rang und dem Alter nach als Armeekommandant entsprach. Der Generalstabschef, jünger und rangtiefer als selbst die Korpskommandeure, hat keine Kommandogewalt; man muß ihm einen älteren General vorsetzen. (Bei uns in Österreich war’s ungefähr auch so.) Im Jargon des preußischen Generalstabs nannte man diesen vorgesetzten Herrn den „Wandschirm“. Bei den meisten Armeen war der Kommandierende wirklich nur dekorativer Wandschirm; wenn es sich um Fürstlichkeiten handelte, bedurfte der Wandschirm nicht einmal des Alters. (Kronprinz Rupprecht und General v. Kuhl; Kronprinz Wilhelm und General v. d. Schulenburg; Mackensen und General v. Seeckt usw.) Der Fall Ludendorff wurde dadurch ein Spezialfall, daß der Wandschirm alle Ehren an sich nahm und ein deutscher Gott wurde. Die Urteilsfähigen wußten, daß Ludendorff, nicht Hindenburg der Kopf des Krieges sei, im Lande aber wuchs, gehoben von der blöden Menge, die Hindenburg-Legende ins Grandiose. Ludendorff hat diese Legende lange nicht gestört, erst als ihm die Sache zu toll wurde, stieß er ein paar Zornrufe aus. Damals konnte man auf die Frage, welchen Anteil Hindenburg z. B. an der Schlacht von Tannenberg hatte, Ludendorffs Antwort hören: „Wußte nicht mal, wo die einzelnen Korps standen.“ Hindenburg selber hat Gerhart Hauptmann als das Denkwürdigste von dieser Schlacht erzählt, daß er während der Schlacht eine Zivilhose angehabt habe; die richtige Felduniform ist ihm erst nachgeschickt worden. Der Mann, der im Felde nicht eine einzige Nacht seinen gesunden Schlaf unterbrach, der sich „wie in der Kur“ fühlte, der aß und trank und zu allem nur sein ewig gleiches Sprüchlein wiederholte: „Nun denn, mit Gott vorwärts!“ – dieser Generalfeldwebel wurde der Abgott der Masse. (Man erinnert sich der schauderhaften Riesenholzfigur, in die man Millionen Nägel einschlug.) Es war gleich, welche Flagge über dem Götzen wehte, ob die kaiserlich-hohenzollernsche, ob die republikanisch-sozialdemokratische, ob das Hakenkreuz – Hindenburg blieb der Gott der patriotischen Massenlüge. Ludendorff war ein toter Hund.
Das deutsche Volk – das unpsychologischste, primitivste aller Völker – hat sich keine Gedanken darüber gemacht, warum sein bester Soldat, vereinsamt und verbittert, in die Netze des Wahnsinns geriet. Von Natur aus unkritisch veranlagt, im Glauben an die Unübertrefflichkeit des deutschen Kaiserreiches aufgewachsen, neigte Ludendorff ohnehin dazu, die Katastrophe von 1918 als ein Teufelswerk zu deuten. (Er hat in seinem Wahn eine ganze Reihe irdischer Teufel entdeckt, die er für Deutschlands Niederlage verantwortlich macht.) Den letzten Stoß aber, der Gemüt und Verstand verdunkelte, hat er zweifellos von dem Triumph der Lüge empfangen, der sein Leben und seine Leistung auslöschte. In seiner Art schrie er damals den Satz hinaus: „Die feilste Dirne ist die Geschichtsschreibung.“ Er hat der Geschichtsschreibung unrecht getan, denn die Wahrheit ist unverlierbar festgehalten. Er erkennt aber nicht, daß es zum Wesen des deutschen Plebejismus gehört, die geschichtliche Wahrheit nicht zur Kenntnis zu nehmen. Die Menge will ein Gipsfigurenkabinett, dessen Helden dem Geschmack des Pöbels entsprechen. Die Rektifizierung der Lüge, wie sie sich jetzt vorbereitet, geht denn auch nicht vom Volke, auch nicht von der sogenannten bürgerlichen Intelligenz aus, schon gar nicht von den deutschen Gelehrten, sondern von den preußischen Offizieren. Man muß es sagen: nur noch unter den preußischen Offizieren ist jene Anständigkeit lebendig geblieben, die dafür sorgt, daß das an Ludendorff begangene Unrecht gutgemacht werde. Der heute herrschende Plebejismus hätte es nie getan.
Es ist eine andere Frage für sich, ob man den verbitterten Mann wiedergewinnen könne, eine andere Frage, ob der Politiker Ludendorff nicht den Soldaten Ludendorff völlig verdrängt hat. In einem Punkt jedoch scheint seine Natur unwandelbar geblieben zu sein: er wird schwerlich für ein Kompromiß mit dem Plebejismus zu haben sein.
[Wiener Sonn- und Montags-Zeitung, Jg. 73, Nr. 15, 15.4.1935, S. 6 (Karl Tschuppik).]
Der kleine Unterschied
Während der letzten Tage war in dem uniformen Druckpapier des Dritten Reiches auffallend viel von Österreich zu lesen. Der Offensive der deutschen Zeitungen lag – alles ist organisiert, Organisation ist alles! – ein doppelter Plan zugrunde: während die zahlreichste Waffe, die Lügenschleuder, eine Unmenge Nachrichten zu verbreiten hatte, die von der schlechten Stimmung in Österreich, von Zwist und Zank erzählten, wurden auch die Denker der deutschen Zeitungsplantagen bemüht, um darzutun, daß es – Österreich nicht gebe. Österreich, so lautet die jetzt propagierte Geschichtsauffassung des Dritten Reichs, sei nie etwas anderes gewesen als ein Stück Deutschlands; es unterscheide sich in nichts von den südlichen Ländern des Reichs, die katholisch seien und ihre eignen Dynastien hatten. Überdies aber – und dies ist das neueste Argument für die Gleichschaltungssehnsucht – gehöre Österreich auch heute verfassungsrechtlich zum Deutschen Reiche. Verfassungsrechtlich? Die Herren, die sonst die Weimarer Verfassung meiden wie der Teufel das Weihwasser, haben plötzlich entdeckt, daß in der Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919 (RGBl. Nr. 152, S. 1383ff.), Art. 61, ein Absatz enthalten ist, der lautet: „Deutschösterreich erhält nach seinem Anschluß an das Deutsche Reich das Recht der Teilnahme am Reichsrat mit der seiner Bevölkerung entsprechenden Stimmenzahl. Bis dahin haben die Vertreter Deutschösterreichs beratende Stimme.“ Die deutsche Reichsregierung ist 1919 veranlaßt worden, den Artikel 61 (Abs. 2) zu streichen, er sei jedoch – so sagt die neue Entdeckung – verfassungsrechtlich nicht außer Kraft gesetzt, da dieser anbefohlenen Tilgung niemals die verfassungsmäßige Form, die Kundmachung im Reichsgesetzblatt, gegeben wurde. Die Entdecker dieses Details argumentieren nun: durch die Streichung des zitierten Absatzes sollte die in den Friedensverträgen enthaltene Möglichkeit des Anschlusses eliminiert werden; da der Versuch mißlang, habe der Artikel seine Gültigkeit behalten; der Völkerbund wäre demnach verpflichtet, nach vorangegangener Abstimmung, den Anschluß zu genehmigen.
Das alles liest sich wie ein schlechter Scherz; der Glaube, daß das zitierte Stück der Weimarer Verfassung gelte, wirkt ebenso komisch wie die Meinung, daß man auf dem Wege der Abstimmung Österreich für das Dritte Reich gewinnen könne. Ernsthaft ist darüber gar nicht zu reden. Es zeigt aber, mit welcher unverdrossenen Zähigkeit daran gearbeitet wird, den Gläubigen des Dritten Reichs einzureden, daß Österreich zu ihnen gehöre. Auf derselben Höhe der Beweisführung stehen die historischen Betrachtungen, wonach es keine Österreicher gebe, der Begriff „österreichisch“ nur eine Erfindung einiger Wiener Literaten sei. Es wäre ein Vergnügen, mit Leuten über dieses Thema zu streiten, deren Meinung der unsern zwar entgegengesetzt ist, aber doch nicht außerhalb aller geschichtlichen Tatsachen liegt. Die Denker des Dritten Reichs dichten sich eine österreichische Geschichte zurecht, die es nie gegeben hat; die paar Tatsachen, die sie anführen, kneten sie wie wächserne Nasen, je nach Belieben. So wenig verlockend es ist, mit dieser Art Geschichtsschreibung zu streiten, so gibt sie doch Anlaß, auf einen Fehler aufmerksam zu machen, der in Österreich begangen wird. Auf der einen Seite bemüht man sich, das allgemeine Denken auf die Wahrheit zu lenken, daß sich das alte Österreich anders entwickelt hat als das von Preußen beherrschte und eroberte Deutschland; auf der andern Seite aber wird ein Mißbrauch mit dem Worte „deutsch“ getrieben, der geeignet ist, die von der borussischen Geschichtsschreibung und von der neuen nationalistischen Ideologie verbreitete Täuschung zu stützen, daß Österreich ein Stück Deutschlands sei. Das neue Österreich ist ein Stück des alten; die Monarchie aber war kein „deutscher“ Staat; im Österreichischen ist mehr enthalten als der deutsche Beitrag. Wir gehören der deutschen Sprachwelt an und hatten Teil an einer Geisteswelt, mit der das Deutschtum von heute nichts mehr gemein hat. Diese völlige Loslösung des Deutschtums von dem ehedem gemeinsamen Besitz ist aber das Entscheidende. Es ist einem Österreicher heute unmöglich, in der gesitteten Welt als „Deutscher“ aufzutreten. Die Behauptung einiger Schwärmer, daß es im Dritten Reich ein sozusagen verborgenes Deutschtum gebe mit Eigenschaften, welche die Welt einst an einzelnen hochstehenden Menschen dieser Nation geschätzt hat – diese Behauptung ist schwer zu glauben; aber selbst wenn sie einen Schimmer von Wahrscheinlichkeit besäße, könnte man dem Europäer nicht plausibel machen, daß ein Volk von fünfundsechzig Millionen gegen seinen Willen barbarisiert worden sei. Der Deutsche wird in der Welt danach taxiert, was Deutschland ist. Der Österreicher hat allen Grund, sein Anders-Sein, das Unterscheidende, das Gegensätzliche zu betonen. Der Begriff „österreichisch“ steht so fest, daß es keiner Erklärung bedarf; das Wort „Ich bin ein Österreicher“ sagt der Welt viel mehr als die langatmige Erklärung: „Ich bin zwar ein Deutscher, aber …“ Es ist nicht unsere Schuld, daß das Wort „Deutscher“ innerhalb der gesitteten Welt diesen entsetzlichen Klang bekommen hat. Auch Australien gehört der englischen Sprachwelt an, aber es wird keinem Engländer einfallen, zu sagen, daß er Australier sei. Österreich gehört zu Europa, zur zivilisierten Welt; das ist das Unterscheidende, Entscheidende.
Wir sind anders als die Deutschen, im Großen wie im Kleinen. Und weil am Kleinen auch der einfachste Sinn den großen Unterschied erfassen kann, will ich eine ganz kleine Geschichte erzählen: Ich saß einmal mit einem befreundeten Priester in der „Traube“ zu Salzburg. Wir aßen eine österreichische Speise: Beuschel mit Knödel. An unsern Tisch hatte sich ein deutsches Ehepaar gesetzt (es war vor der 1000-Mark-Sperre). Das fremde Paar interessierte sich für unser Essen (wobei leider die Vermutung des Mannes, daß es sich um „Lungengekröse“ handle, unsern Appetit fast verdorben hätte). Die Deutschen ließen sich „Beuschel“ mit Knödel geben. Es schmeckte ihnen so gut, daß der Mann zur Frau sprach: „Ach, Klothilde, laß dir doch mal vom Direktor die Anweisung geben. Das müssen wir zu Hause versuchen.“ Worauf mein Freund, der gute Österreicher:
„Verehrter Herr, so einfach, wie Sie meinen, ist die Sache nicht! Auch dieses Beuschel setzt sechshundert Jahre Habsburg und Katholizismus voraus!“
[Wiener Sonn- und Montags-Zeitung, Jg. 73, Nr. 17, 29.4.1935, S. 8 (Karl Tschuppik).]
Mama, was ist ein Leutnant?
Mit der gespielten Naivität eines Backfisches, der die Mama fragt, was ein Leutnant ist, mimt die deutsche Regierung die keusche Unschuld vor der Frage, was denn Einmischung in die staatlichen Angelegenheiten Österreichs eigentlich bedeute. Diese Rolle des unschuldsvollen Mädchens zu spielen ist dem Dritten Reich von Italien ermöglicht worden, das sich, aus nahen und weiteren Gründen, neuerdings bemüht, Deutschland die vorgesehene Donaukonferenz schmackhaft zu machen. Die Gespräche, die Italiens Außenminister mit Herrn von Hassel, dem deutschen Botschafter in Rom, seit Tagen führt, kreisen um das Thema Österreich, insbesondere um jene Bestimmung des französisch-italienischen Protokolls vom 7. Jänner 1935, worin gesagt ist, daß jede gewalttätige Propaganda verboten sein solle, die dahin ziele, die Unantastbarkeit Österreichs und das politische Regime des Landes zu schädigen. Die Bestimmung des Protokolls ist ganz klar: es soll in Zukunft verhütet werden, was in der Vergangenheit geschehen ist, daß ein fremdes Land durch Bestechung und Beeinflussung, durch Emissäre und Waffenlieferanten einen Druck auf Österreich ausübe. Bei den Besprechungen befolgt Deutschland nun die Taktik, sich anscheinend mit der Verurteilung einer gewalttätigen Agitation in Österreich einverstanden zu erklären, zugleich aber fordert es, daß dem Nationalsozialismus jede andere Art von Agitation gestattet werde; bei einer solchen Interpretation des Protokolls vom 7. Jänner wäre es geneigt, sich an dem gemeinsamen Werk eines Donauvertrages zu beteiligen.
Man könnte dieses Ansinnen mit dem Hinweis auf die Rede des Bundeskanzlers Dr. Schuschnigg erledigen, der den Grundsatz ausgesprochen hat, daß die Beurteilung und Wertung einer Agitation innerhalb der Grenzen unseres Landes ausschließlich Österreichs Angelegenheit sei. Die österreichische Regierung ist zur Überzeugung gelangt, daß der Nationalsozialismus in seinen Methoden, Absichten und Zielen mit den Gesetzen Österreichs, mit dem österreichischen Staatsgedanken und den sittlichen Anschauungen des Landes sich nicht vereinen lasse; die Entscheidung darüber, ob eine solche Bewegung zu dulden oder zu verbieten sei, ist Österreichs, nur Österreichs Sache. Das Ansinnen Deutschlands, hier mitbestimmen zu wollen, sich ein Recht des Urteilens zu arrogieren, was Österreich frommt und was nicht, stellt schon eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten dieses Landes dar. Wir kennen sehr gut jene Berufung auf ein nebelhaftes Naturrecht, mit welcher man solche Einmischungen zu maskieren versucht; es sind Argumente, die dem ungebildeten und halbgebildeten Nachläufer des Nationalsozialismus imponieren mögen; in dem durch Gesetz und Sitte geordneten Leben der zivilisierten Staaten ist für derlei Narrheiten kein Platz. Außerdem aber enthält die Annahme, daß die nationalsozialistische Bewegung ein Naturprodukt sei, dem zur vollen Entfaltung nur die Freiheit fehle, eine grobe Lüge.
In seinem Buche „Mein Kampf“ schildert Adolf Hitler die Aversion gegen Wien und sein ehemaliges Heimatland; er selber weiß es am besten, daß er in Wien niemals zur Rolle eines Volkstribunen aufgestiegen wäre. Seine Vorgänger, die K. H. Wolf und Schönerer, mußten sich mit einer sehr kurzen Laufbahn bescheiden; aus einem einfachen Grund: Österreich war, mit Ausnahme Deutschböhmens, wo jetzt Herr Henlein triumphiert, für das Gemisch aus Rassenwahn und provinzialem Teutonismus nicht zu haben. Nach einem kurzen Siegeslauf zwischen Trautenau und Aussig hat Herr Wolf als Schachspieler im „Café Central“ geendet. Die neue Auflage des Teutonismus war erst recht nicht danach beschaffen, in Österreich eine Volksbewegung zu werden. Selbst unter den freien Gesetzen der parlamentarischen Demokratie, die jedem Unfug zügelloser Agitation freie Bahn ließen, vermochten die Nationalsozialisten keine nennenswerte Stimmenanzahl zu gewinnen. Erst die Erfolglosigkeit der erlaubten Mittel gebar den nationalsozialistischen Einfall, sich mit Gewalt, mit Drohung, Mord und Totschlag zu holen, was man auf normale Weise nicht gewinnen konnte. Es ist eine traurige Pflicht, immer wieder jenen Weg aufzuzeigen, den der Nationalsozialismus in Österreich zurückgelegt hat: der Weg ist mit Leichen und Trümmern besät. Wäre der Nationalsozialismus eine wirkliche Volksbewegung gewesen, getragen von der Überzeugung seiner Anhänger, dann hätte er nicht notwendig gehabt, zu den Mitteln des Banditentums zu greifen. Das Volk kann als Masse grausam, in der Empörung rachsüchtig sein, es hat aber noch niemals eine Volksbewegung gegeben, die sich auf die Schleichwege des Verbrechens begeben hätte.
Das Verlangen Deutschlands, einer Partei freie Bahn zu geben, deren Geschichte nichts anderes als ein langes Strafregister enthält, ist undiskutierbar. Die strafgerichtliche Verbrechenschronik weist nicht nur die einzelnen Straftaten nach, sie zeigt an Hunderten Exempeln den Zusammenhang zwischen den verbrecherischen Subjekten und ihren Auftraggebern auf. Angesichts dieser unumstößlichen Tatsachen klingt es wie Hohn, wenn die diplomatischen Wortführer des Dritten Reiches mit dem Augenaufschlag der Unschuld danach fragen, was „Einmischung“ bedeute. Ist zu wenig gemordet und zerstört worden in Österreich? Sind die Toten vergessen? Kann man aus dem Gedächtnis tilgen, daß die Organisatoren des Mordes und ihre Helfer als Helden in Deutschland gefeiert wurden? Es war ein sehr plumper Trick, nach jedem Verbrechen, dessen Zusammenhang mit den Auftraggebern urkundlich nachgewiesen wurde, die Methode der doppelten Buchführung zu praktizieren; obzwar man im Innern die „Totalität“ des Staates, die Einheit von Partei und Verwaltung proklamierte, ward auf dem Terrain des Verbrechens plötzlich unterschieden zwischen Partei und dem Staate. Bezahlte Leute meuchelten den Kanzler; Hakenkreuzträger mordeten auf tirolischem Boden; mit deutscher Munition wurden Brücken und Bahnen gesprengt – die Staatsverwaltung war unschuldig, die Partei hat es getan; die Emissäre mit Geld, Sprengmitteln und Mordwaffen waren nicht Funktionäre des Staates, sondern Rekruten der Partei. Diese Unterscheidung, zynisch durchgeführt, hat die Welt nicht zu täuschen vermocht. Solange das Hakenkreuz herrscht, bleibt es für seine freiwilligen und bezahlten Agenten verantwortlich. Daran kann auch die neue Rolle der Unschuld nichts ändern, die Deutschlands Beauftragte augenblicklich in Rom spielen.
[Wiener Sonn- und Montags-Zeitung, Jg. 73, Nr. 23, 11.6.1935, S. 7 (Karl Tschuppik).]
Man neckt uns in Asch
Wir hatten einen Geographie-Professor – es war in den Neunzigerjahren –, der meinte, Asch entschuldigen zu müssen; die Stadt, sagte er, liege zwar im Königreich Böhmen, aber so nahe der Grenze, daß sie bei der geringsten Bewegung ausrutsche und dann drüben sei. Wenn die Ascher aus dem Fenster blickten, so blieben sie mit dem Hintergestell im Lande; mit dem Kopf und dem Herzen waren sie drüben. Das alte Österreich hatte sein Gfrett mit den Aschern. Ihnen war es auf keinerlei Art recht zu machen. Schon im Jahre 1848, als die Frankfurter Nationalversammlung den großdeutschen Traum verwirklichen wollte und den nichtdeutschen Volksstämmen Österreichs die vollste Freiheit der Entwicklung auf dem Boden des Deutschen Bundes versprach, da war es der Abgeordnete von Asch, der sehr erbost gegen die „Begünstigung der Slawen“ wetterte und dem „nationalen Feind“ das gleiche Recht nicht zugestehen mochte. Aus dem großdeutschen Traum ist nichts geworden, aber mit der kleindeutschen Lösung waren die Ascher erst recht nicht zufrieden. Der Winkel von Asch wurde der nationalistische Wetterwinkel Österreichs. Dort zogen sich jene Donnerwetter zusammen, die dann krachend in Deutschböhmen niedergingen und in der deutschtümelnden Presse Wiens ihr pathetisches Echo fanden. (Sähen die Bacher und Benedikt, wie ihr teutonisches Bemühen belohnt wurde, sie müßten sich vor diesem Dank vom Hause Germanias im Grabe umdrehen.) Die Ascher haben mit dem ewigen Krakeel unmittelbar zwar nichts erreicht; das alte Österreich ist zerfallen, und sie selber gehören heute der tschechoslowakischen Republik an. Als Entgelt dürfen sie aber stolz darauf sein, daß ihr Geist Deutschland erobert und all das, wonach sie sich so viele Jahrzehnte gesehnt, drüben die Erfüllung gefunden hat. Es steckt vielleicht ein tieferer Sinn darin – die Hegelianer der deutschen Geschichtsbetrachtung mögen sich darüber die Köpfe zerbrechen –, daß die Erneuerung und eigentliche Vollendung Preußen-Deutschlands von der Stadt mit dem onomatopoetischen Namen ausgegangen ist. Die Schönerer, Bareuther, Iro und Tins haben es immer gesagt: Am Ascher Wesen wird Deutschland genesen. Die geschichtliche Wahrheit fordert es, zu sagen, daß das Dritte Reich ohne Asch und seine Männer gar nicht denkbar wäre. In den alten Jahrgängen der „Unverfälschten deutschen Worte“ ist das Deutschland von heute bereits enthalten wie das Huhn im Ei. Nur muß man den Männern von Asch zugestehen, daß sie ihre Schüler und Plagiatoren an Originalität weit übertroffen haben, wie denn auch neben den Stilisten des Hakenkreuzes die Schriftleiter des Asch-Bezirks als Herder und Schiller erscheinen.
Kein Zufall danach, daß das Geheimnis der nächsten Zukunft Deutschlands in Asch liegt. Es nützt nichts, sich dagegen zu sträuben, und wenn Herr Alfred Rosenberg den Mythos auch auf anderem Wege sucht: Asch ist der Nabel der deutschen Welt; Asch ist die produktive Stätte der ewigen Erneuerung germanischen Wesens. Er, der Gründer der Sudetendeutschen Front, der Vollstrecker des Ascher Gedankenguts und Willens, Herr K. H., ist, so bekennen es heute schon die Getreuesten, noch viel bedeutender. Nach der Geschichtsphilosophie von Asch verhält es sich nämlich so, daß das Ahnen und Sehnen des Volks zwar untrüglich, die Auffindung des Ganz-Großen aber an eine gewisse Zeit gebunden sei; der Ganz-Große bedürfe des Vorbereiters und Wegeebners, um dann, im strahlenden Licht der letzten Erweckung, auf den Thron zu steigen. Konrad Henlein, der Ascher Turnrat, ist, so sagen es alle, die ihn kennen, viel bedeutender; er hat die tiefe Kniebeuge zur Grundhaltung des deutschen Bewußtseins erhoben – Hände in die Seite, Kopf in Asch.
Umso bedauerlicher, daß sie, die Ascher, Österreich so gram sind. Im Gegensatz zu drüben, wo mit schwerem Geschütz geschossen wird, halten sie es mit den leichten Waffen des Witzes und der Satire. Vor uns liegt die August-Nummer der „Satirischen Monatsschrift der Sudetendeutschen“, „Der Igel“, von deren zwölf Seiten vier Österreich gewidmet sind. Das Titelblatt zeigt den Österreicher, tief gebückt vor dem Hermelin der Habsburger, und der Witz besteht darin, daß der Hermelin gestopfte Löcher aufweist. Ein ganzes Panorama „O du mein Österreich!“ läßt den Wirrwarr, die Rauflust und den Spektakel im Donauland sehen. Die Wahrheit der satirischen Berichterstattung erkennt man am besten aus dem Bilde, das ein völlig leeres Alpenhotel darstellt, vor dem die sehnsüchtig nach Bayern blickenden Wirtsleute traurig stehen. Genau so war’s, wie wir wissen, diesen Sommer in den österreichischen Alpen! Auch mir widmet der „Igel“ ein Stück seines Papiers. Ich bin zwar nicht böse; ich geniere mich nicht, meine Ansicht über den Teutonismus der Sudetendeutschen zu sagen, also muß ich auf Antworten von dort gefaßt sein. Die „Elegie“, die mir das Blatt schrieb, zeigt aber, auf welcher Tatsachenkenntnis die sudetendeutsche Polemik ruht. Drum setze ich die letzten Strophen her:
Wenn es in Österreich nicht klappt,
Wenn Mussolini Schuschnigg schnappt,
Wenn Zita an der Grenze tänzelt,
Und Starhemberg vor Otto schwänzelt,
Dank Tschuppiks Feder
Weiß jetzt ein jeder,
Daß Unheil, gleichviel wie es heißt,
Entspringt sudetendeutschem Geist.Es gibt für jene Unglücksmänner,
So sagt Herr Tschuppik nämlich, wenn er
Mit seinem Eigengeist uns blendet,
Nur einen Weg, der glücklich endet.
Man lasse sichUnweigerlich
Um nicht als Wilder zu verrecken,
Von Wiener Hochkultur belecken.Herr Tschuppik selber lebt in Prag,
Jost Kren.
Wahrscheinlich, weil er Wien so mag,
Ich glaube gar, er hat die Leitung
Einer sudetendeutschen Zeitung.
Da schrieb er wohl
Den ganzen Kohl
Der Wiener Zeitung nur im Scherze?
Na ja … Zum Wohl! Prost Druckerschwärze!
Das alles stimmt so wie der Hohn über Österreichs Fremdenverkehr 1935, es ist so exakt wie alles, was der nazistische Ernst und Witz von Österreich zu melden weiß. Vom Ascher Igel auf den deutschen Aar schlüssig projiziert, kommt bei dieser Exaktheit und Tatsachenkenntnis die neue deutsche Wissenschaft heraus. Sie basiert bekanntlich auf dem „Gefühlsmäßigen“. Und dieses Gefühlsmäßige – was bedeutet es?: die Abwesenheit der Wahrheit.
[Wiener Sonn- und Montags-Zeitung, Jg. 73, Nr. 35, 2.9.1935, S. 6 (Karl Tschuppik).]
Deutsche, Nummer 4a
Wer sind diese „4a“-Deutschen? Sind es, analog den Bezeichnungen der sogenannten Straf-Bataillone im Kriege, Insassen von Strafanstalten? Sind’s minderrassige Volksgenossen, die mit dieser Degradation vorliebnehmen müssen? Sind es die „ausgebürgerten“, die staatenlosen Deutschen? Nein, die „4a“-Deutschen sind wir, die Österreicher. Ein Mann, der draußen im Reich heute sehr ernst genommen wird, der Danziger Universitätsprofessor Bernhard Lembke, hat eben eine Studie veröffentlicht, in der er es unternimmt, die verschiedenen Arten der Deutschen, wie er sagt, „endgültig festzustellen und zu werten“. Er möchte auf das deutsche Volk die Methode des Naturforschers Linné anwenden, der bekanntlich Tiere und Pflanzen rubriziert hat, ohne freilich die Schöpfung nach einem Rangregister zu ordnen. Professor Lembke hat gefunden, daß es innerhalb des deutschen Volkes zweiunddreißig verschiedene Arten gebe; die Unterscheidung und Wertung unternimmt Herr Lembke nach den Begriffen Blut, Sprache, Staat und Willen, wobei das „Blut“ als das entscheidende Element an erster Stelle steht. Entsprechend dieser Wertungsskala rubriziert Herr Lembke die Deutschen in „staatszugehörende Blutdeutsche“, in „reichsfremde Blutdeutsche“, in „reichstreue Sprachdeutsche“, in „reichsfremde Sprachdeutsche“, in „sprachfremde Willensdeutsche“, „willensfremde Reichsdeutsche“ und so weiter; es ist nicht Raum genug, alle zweiunddreißig Arten aufzuzählen. Die Österreicher rangieren als „reichsfremde Willensdeutsche“ erst unter der Rubrik „4a“, also nicht gerade sehr hoch.
Es werden wahrscheinlich viele Leute geneigt sein, den Entdecker der deutschen Arten nicht ernst zu nehmen, ihn vielmehr in die Galerie jener wunderlichen Gelehrten einreihen wollen, die zur Praxis des Dritten Reichs die Theorie liefern. Man darf aber nicht vergessen, daß diese professoralen Dienstboten nur verarbeiten, was in der politischen Praxis grundsätzlich anerkannt wird. Sie gehen darin in ihrem Übereifer allerdings manchmal so weit, daß sich ihre Herrschaft kompromittiert fühlt, sie plaudern wie der Zwerg Mime aus dem Schlafe und wecken dann den Zorn manches der Gebieter, der, wie unlängst Herr Streicher, an den Gebildeten seinen Zorn ausläßt. So seltsam jedoch, als Spielerei eines Gelehrten, die Rubrizierung Österreichs anmuten mag, so spricht aus der Arbeit des Professors Lembke doch ein politisches Bekenntnis.
In den Tagen, da Deutschland um Österreich warb, bemühten sich die schmeichlerischen Anschlußfreunde, den staatlichen Zuwachs als kulturellen Gewinn hinzustellen; damals war Österreich „die Ergänzung, die Deutschland fehle“. „Solange Grenzpfähle das Stück deutschen Kulturbodens vom Mutterlande trennen“, rief einer der enragiertesten Prediger des Anschlusses, „wird Deutschland trotz seiner Größe ein körperlicher und seelischer Torso bleiben … Indem die Vielgestaltigkeit des deutschen Volkes durch die Stammeseigenart des österreichischen Volkes vermehrt wird, tritt ein neues Instrument von besonderer Art in das deutsche Orchester, das nun erst in voller Pracht zu erklingen vermag. Denn was Österreichs Eigenart dem Reiche zu bieten hat, ist gerade das, was ihm fehlt.“ Aus diesem von der Entwicklung Preußen-Deutschlands längst überholten Wunsch sprach insofern ein Stück Wahrheit, als die Geltung Deutschlands auf kulturellem Gebiet fast ausschließlich von Österreichern bestritten wurde. Es war die Folge der deutschen Geschichte seit 1871, daß das große Reich an Talentschwund litt; die Militarisierung und Kommerzialisierung des gesamten Lebens im Reich veränderte den deutschen Menschen derart, daß für die edlen Luxusbedürfnisse kein Hirn übrigblieb. Die Jahre nach dem siegreichen Kriege waren die kulturell dürrsten Jahre Deutschlands. Damals schrieb Nietzsche den Satz, von allen schlimmen Folgen des Sieges sei die schlimmste der Irrtum, daß auch die deutsche Kultur gesiegt habe und mit den Kränzen geschmückt werden müsse, die so außerordentlichen Begebnissen und Erfolgen gemäß seien; der Wahn sei verderblich, weil imstande, den Sieg in eine völlige Niederlage zu verwandeln: in die Niederlage, ja „Exstirpation des deutschen Geistes“ zugunsten des Deutschen Reiches.
Die Befürchtung ist von den Ereignissen bestätigt worden. Die Exstirpation des Geistes war endgültig. Deutschland erlebte die große wirtschaftliche Blüte, Berlin schwoll zur Dreimillionenstadt, der Reichtum verlangte auch nach den Künsten. Berlin wurde die führende deutsche Theaterstadt. Doch wer waren die Namen, die der Reichshauptstadt zu diesem Glanze verhalfen? Nach der Episode Brahm, dem Theater des Naturalismus, waren es österreichische Künstler, Direktoren, Regisseure, Dirigenten, Komponisten, die Berlins Kunstleben bestritten. Preußen-Deutschland hatte sich damit abgefunden, daß es ihm nicht vergönnt sei, die geistigen Bedürfnisse mit eigenen Kräften zu befriedigen; Wien war die anerkannte Quelle, die den deutschen Kunstbetrieb speiste. Seit der Flucht der Österreicher aus Berlins Kulissenreich, aus den Verlagen und den Konzertsälen starrt uns große Öde entgegen.
Das Dritte Reich weint dem verlorenen Glanz keine Träne nach; es hat andere Götter. Mit dem wirklich Österreichischen weiß es im Grunde nichts zu beginnen, aber auf die Beglückung der Österreicher möchte es nicht gern verzichten. Zu den Werbemethoden dieser Beglückung gehörte es bisher, die Parteigänger in Österreich in dem Glauben zu wiegen, ihre Donauheimat werde dereinst Germanias Lieblingskind sein, die Provinz römisch Ia des alldeutschen Imperiums. Professoren aber schwatzen aus der Schule, was die Politiker sich nur mit den Augen sagen: Voll Staunen können es die Verblendeten hierzulande jetzt im Buche des Danziger Professors lesen, daß sie im Ernstfalle nur Nummer „4a“ wären, weit hinter Tegernsee, Dachau und Daglfing.
Das Alpenjuwel, um dessen Kostbarkeit propagandistisch Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, genug Worte und Tinte vertan wurden, ist also in Wahrheit nur als Anhängsel an der breiten Bauernuhrkette „Bayern“ gedacht, die die preußische Weste schmückt? Welcher sonderbare Widerspruch zwischen Werbung und Wertung! Es ist, als würde sich ein Langfinger auf der Straßenbahn von der Uhr, nach der seine Hand gerade begehrlich vortastet, sagen: „Is eh ein’ Dreck wert!“
[Wiener Sonn- und Montags-Zeitung, Jg. 73, Nr. 36, 9.9.1935, S. 6 (Karl Tschuppik).]
Butterbrot und Weltanschauung
„Der Schlüssel zu allem Unglück der Völker ist ihre Dummheit. Alle politischen oder wirtschaftlichen Erklärungen sind nur literarischer Aufputz für diese tiefe Dummheit, die fast unheilbar ist und sich seit den geschichtlichen Zeiten nicht wesentlich gebessert hat.“
Maurice Maeterlinck, „Vor dem großen Schweigen“
Die lapidare Erkenntnis aus Maeterlincks letztem Werk, daß die Völker dem Kretinismus rettungslos verfallen seien, hat neulich einem Mann der „Frankfurter Zeitung“ einiges Kopfzerbrechen bereitet; er nannte es „greisenhaften Pessimismus“, die Entwicklungsfähigkeit der modernen Nationen leugnen und nicht begreifen zu wollen, daß der Weg der Völker über Berg und Tal führe, einem Höhepunkt ein Tiefpunkt folge, von welchem es wieder einmal aufwärtsgehen müsse. Diese „Railway“-Theorie mag als Beschwichtigungsglauben taugen in desperaten Zeiten, als ein Mittel, sich über peinliche Erscheinungen hinwegzutäuschen, sofern man die Wahrheit nicht sagen will oder nicht sagen darf; ernsthaft aber ist sie als Tröstung nicht zu brauchen. Was Maeterlinck am Ende eines reichen Lebens mit dem Blick auf Europa sagt, kommt der Wahrheit näher. Sein Ausspruch enthält die ganze Enttäuschung eines großen Geistes, der alle Illusionen aus besseren Tagen verabschiedet und mit jenem Mut zur Aufrichtigkeit, die man vor dem Grabe gewinnt, die letzte Erkenntnis ausspricht.
Der einzige Einwand, den man gegen Maeterlincks Pessimismus erheben könnte, ist ein Trost der Bescheidenen, die sich sagen, daß sein Satz nicht für alle Völker gelte. Es gibt Nationen, die den Gebrauch der Vernunft – und darum handelt es sich – durch glückliche Fügung, im Laufe langer Zeiten, als nützlich und vorteilhaft erkannt haben. Wir sind freilich heute so weit gekommen, daß es innerhalb gewisser Erdteile – es sind, bei Gott, nicht die schwarzen – notwendig wäre, ein Plaidoyer für die Vernunft zu halten. Da es der Beruf des Kretinismus ist, der Vernunft gram zu sein, hat man eine eigene „Weltanschauung“ mit Ausschluß der Vernunft erfunden, in der bald dieses, bald jenes irrationale Element als die eigentliche bewegende Kraft eingesetzt wird. Mit diesen Exzessen des Kretinismus verhält es sich ungefähr so, als wollte jemand die Schwerkraft leugnen und einen Bau aufführen, der die Gesetze der Schwerkraft ignoriert. Solange die Natur von Gesetzen beherrscht wird, die man mittels der Vernunft erkennen und experimentell nachweisen kann, wird der Gebrauch der allerhöchsten Kraft, der Vernunft, der einzige Wegweiser sein, Katastrophen, Niederlagen, Bankrott, Not und Elend zu vermeiden. (Religiösen Gemütern müßte man den Satz aus Hegels „Philosophie der Geschichte“ mitteilen: „Gott will nicht leere Köpfe zu seinen Kindern, sondern solche, deren Geist reich an Erkenntnis seiner selbst ist.“) Es ist im Völkerleben nicht anders als im Dasein des einzelnen; wer der Vernunft folgt, wird vor Ungemach und Schaden bewahrt.
So weit, allerdings, halten die Prediger des Irrationalen auch. Es ist, wenn man so sagen darf, ihre doppelte Buchführung, in ihrem privaten Dasein einer praktischen Vernunft zu folgen, die den Vorteil sichert und vor Unglück bewahrt; im Großen jedoch, im Politischen und, wie sie gern sagen, im „Welthistorischen“ spielen sie den wilden Mann. Es ist typisch für die repräsentativen Figuren dieser Zeit, daß sie die Zweiteilung von „privat“ und „politisch“ sehr genau einzuhalten wissen. Im kleinen privaten Dasein ist man auf den Kreuzer genau, vorsichtig, auf jeden Vorteil bedacht, der Ratio brav folgend, sich und die Seinen sichernd. Als Anwalt seiner politischen Richtung, als Repräsentanten der „Weltanschauung“, ist diesem selben Typus nichts teuer genug. Der Staat? Da wird gewirtschaftet, als ob alle Keller voll Goldes wären, da gilt kein Gesetz der Wirtschaft, keine kaufmännische Überlegung, kein Bedenken der Vernunft. Dem Einwand, daß der Staat nicht anders als ein großes Unternehmen zu verwalten sei, mit Vernunft, Vorsicht und Korrektheit, wird der Irrationalist mit Hohngelächter begegnen: Der Staat ein Geschäft? Der Staat ist ein Experimentierfeld der „Weltanschauung“, ein Tummelplatz der Narrheit. Maeterlinck hat recht: die Völker wollen es so haben, der Schlüssel zum Unglück ist ihre eigene Dummheit.
Natürlich stimmt die Rechnung eines Tages nicht; eines Tags gibtʼs – um dieses Beispiel zu wählen – keine Butter mehr. (Ich weiß, was mir die Weltanschauungs-Schöpse erwidern werden: die Geschichte sei schuld; das „Schicksal“ sei schuld; die Verschwörung der Feinde sei schuld.) Das Ausbleiben der Butter ist ein notwendiges Glied in der Kette der gewollten, bewußt hervorgerufenen Ereignisse. Von dem gesamten Butterexport der Welt nimmt England 87 Prozent auf; das Fünfundsechzigmillionenvolk, von den Irrationalisten geführt, muß sich mit 11 Prozent begnügen. Drüben in England kostet die Butter – in österreichischer Währung – pro Kilogramm S 3.50; der arme deutsche Mann muß dasselbe Stück mit S 7.– bezahlen. Die beste Butter, die der Engländer ißt, kostet weniger als der letzte Fettersatz im Reiche der Vernunftverächter. Das ist das Dilemma dieser Welt: man muß sich entscheiden, ob man Butterbrot oder „Weltanschauung“ will.
Die platte Dummheit und jene gelehrte Düpierung, die in Herrn Werner Sombart ihren Fahnenträger gefunden hat, kleidet das Dilemma zwischen Butterbrot und „Weltanschauung“ in die Antithese von „Helden und Händlern“. Diese Antithese ist eine der simpelsten Bauernfängereien. Denn gerade England hat in seiner Geschichte und in der Gegenwart bewiesen, daß der Held nicht notwendig dumm und hungrig, der Händler nicht notwendig fett und feig sein müsse. Dort, wo mit Vernunft regiert wird, gibt es Tapferkeit und Butterbrot. Der Entzug des Butterbrots ist die Strafe, die die rächende Vernunft ihren Verächtern auferlegt.
[Wiener Sonn- und Montags-Zeitung, Jg. 73, Nr. 44, 4.11.1935, S. 7 (Karl Tschuppik).]
Alle Texte als PDF